„Eine Bioökonomie, in der wir alle aktiv sind“
Nachhaltigkeitsanalyst Uwe Fritsche spricht im Interview über Strategien für eine zukunftsfähige Bioökonomie, die breit in die Gesellschaft eingebettet ist.
Nachhaltigkeitsanalyst Uwe Fritsche spricht im Interview über Strategien für eine zukunftsfähige Bioökonomie, die breit in die Gesellschaft eingebettet ist.
Martin Hager forscht an selbstheilenden Materialien und nimmt sich dafür die Natur zum Vorbild.

Das Potenzial pflanzenbasierter Proteine für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion ausschöpfen – diesem Ziel haben sich Volker Heinz und sein Team vom Technologiezentrum "Proteine der Zukunft" in Quakenbrück verschrieben.

Alternative Agrarsysteme wie das „Vertical Farming“ sind ein Schwerpunkt der Forschungsarbeit von Susanne Baldermann. Mit Blick auf eine gesunde, nachhaltige Ernährung nimmt die Lebensmittelchemikerin unter anderem sekundäre Pflanzenstoffe ins Visier.

Die Hohenheimer Agrarökonomin Martina Brockmeier wurde im November 2021 mit großer Mehrheit zur künftigen Präsidentin der Leibniz-Gemeinschaft gewählt. Bioökonomie-Forschung liefert aus ihrer Sicht wichtige Beiträge, um die globalen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Der Agrarökonom Peter Breunig engagiert sich im öffentlichen Diskurs um eine klimaneutrale Landwirtschaft und zeigt, welche Vorteile Klimaschutz der Landwirtschaft bietet.

Der Potsdamer Molekularbiologe Philip Wigge erforscht die Mechanismen, mit denen Pflanzen Umgebungstemperaturen erfassen und sich anpassen.

Das Unternehmen von Torben Schierbecker akquiriert und vermittelt biogene Roh- und Reststoffe zur Weiterverarbeitung, um die Kreislaufwirtschaft in Schwung zu bringen.

Der Jenaer Geoökologe Söhnke Zaehle erforscht, wie sich Nährstoffe wie Stickstoff auf die Stoffkreisläufe von Ökosystemen auswirken.

Als Co-Vorsitzende des neuen Bioökonomierates der Bundesregierung möchte Iris Lewandowski die öffentliche Debatte zum Thema biobasiertes Wirtschaften stärken. Die Agrarwissenschaftlerin der Universität Hohenheim setzt sich für eine moderne sowie ökologisch verträgliche Landwirtschaft ein.

Die Auswirkungen des Kimawandels auf die Biodiversität im Boden stehen im Forschungsfokus von Leibniz-Preisträger Nico Eisenhauer.

Leibniz-Preisträger Rolf Müller sucht in Myxobakterien nach neuen Naturstoffen mit innovativer Wirkweise zur Behandlung von Infektionskrankheiten.

Linus Stegbauer will mithilfe von Mikroalgen das Stadtklima verbessern und Fassadenelemente für Gebäude entwickeln, die mit einem speziellen Biofilm aus lebenden Mikroalgen beschichtet sind.

Pflanzenforscherin Maria von Korff Schmising will mit der Züchtung mehrjähriger Getreidekulturen die Nahrungsmittelproduktion nachhaltiger machen.
Daniel Pleißner hat gemeinsam mit Partnern eine mobile und modulare Bioraffinerie entwickelt, die Lebensmittelabfälle noch vor Ort in hochwerte Rohstoffe für neue Lebensmittel umwandeln kann.

Der Aachener Pflanzenbiotechnologe Holger Spiegel erforscht, wie sich Tabakpflanzen im Gewächshaus zu effizienten Molekülfabriken für die Biomedizin umfunktionieren lassen.

Sascha Peters ist Materialexperte und Trendscout für neue Technologien. Er ist überzeugt: Die Rückführung der Ressourcen muss schon bei der Produktgestaltung bedacht werden.

Der Nachhaltigkeitsforscher Dirk Messner ist seit Januar dieses Jahres Präsident des Umweltbundesamtes. Im Interview spricht er über Chancen und Herausforderungen auf dem Weg in eine biobasierte Wirtschaft, die Corona-Pandemie und den Wert globaler Vernetzung.

Ulrich Schurr will das Rheinische Braunkohlerevier zu einer Modellregion für eine nachhaltige Bioökonomie machen. Dabei setzt er auf die regionalen Stärken und Gegebenheiten, um den Strukturwandel zu meistern.

Die Leipziger Helmholtz-Forscherin Daniela Thrän untersucht systematisch Deutschlands Weg in die Bioökonomie. Als Mitautorin des ersten Bioökonomie-Monitorings kennt sie die Stärken und Schwächen des biobasierten Wandels.

Jan Schirawski untersucht das Erbgut von Brandpilzen, um die Wirkweise des Pflanzenschädlings besser zu verstehen.

Vera Meyer ist von Pilzen fasziniert: Als Biotechnologin will sie das Stoffwechselpotenzial der Lebenwesen nutzen, um der Bioökonomie Leben einzuhauchen, und gleichfalls mit Kunst begeistern.

Der Zukunftsforscher Siegfried Behrendt über den notwendigen Strategien-Mix auf dem Weg in eine biobasierte, nachhaltige Wirtschaft.

Bernd Duna hat mit Resysta einen nachhaltigen Holzersatzstoff entwickelt, der dem begehrten Tropenholz gleicht, aber überwiegend aus Reishülsen besteht.

Matthias Kinne und sein Team wollen mit überholten Technologien in der Lausitz Schluss machen. Im Projekt LaNDER3 setzen die Akteure daher auf regionale Pflanzen zur Herstellung von Hightech-Verbundstoffen.

Der Berliner Politikwissenschaftler Peter Feindt untersucht, wie biobasierte Wirtschaftssysteme mit Schockereignissen und Stress umgehen können. In der Corona-Krise ist das Thema Resilienz hochrelevant.

Seit 2013 entwickelt PAPACKS Verpackungen und Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen.
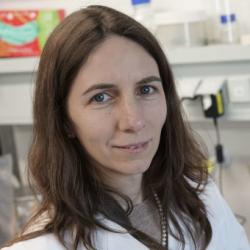
Die Biochemikerin Miriam Rosenbaum aus Jena ist Pionierin der Elektrobiotechnologie. Im Interview erläutert sie, wie sie Sauerstoff in Biotech-Prozessen ersetzen will.

Das Start-up Monitorfish entwickelt ein digitales Frühwarnsystem für Aquakulturen. Mithilfe Künstlicher Intelligenz will das Team um Dominik Ewald Wasserqualität und Tierverhalten überwachen und den Züchtern Abweichungen melden.

Der Mikrobiologe Jörg Overmann will die Vielfalt der Bakterien erforschen und setzt dabei auf Künstliche Intelligenz.

Der Tierarzt Jens Baltissen über moderne Züchtungsansätze bei Milchkühen, auf die Bioökonomieforscher im Bundesverband Rind und Schwein setzen.

Die Bonner Zoologin Vera Rduch über die Ziele der Initiative German Barcode of Life (GBOL).

Am Berliner Naturkundemuseum beschäftigt sich Jörg Freyhof mit dem Potenzial der biologischen Vielfalt für ein biobasiertes Wirtschaften.

Gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Kommunen sucht Frieder Rubik nach neuen Strategien, um Plastikverpackungen im Handel zu vermeiden.

Ein Team um Dag Heinemann kombiniert Lasertechnik mit der Genschere CRISPR-Cas, um die Züchtung von Kartoffeln zu beschleunigen.

Der Kunststoffexperte Benjamin Baudrit berichtet über das neue Webportal BioFoN, das Akteure zum Thema biobasierte Polymere vernetzen will.

Zwei Kuratorinnen des Futuriums über biobasierte Zukunftsthemen in der neuen Ausstellung.

Tiemo Arndt von der Papiertechnischen Stiftung über Trends und Herausforderungen in der Papierherstellung.

Der Pflanzenforscher Tonni Andersen ist Kovalevskaja-Preisträger 2019. Er will verstehen, wie Wurzeln sich mit Bodenmikroben austauschen und baut am Max-Planck-Institut in Köln eine neue Arbeitsgruppe auf.

Trockene Maisspindeln statt Holzkohle: Mario Sacilotto setzt auf Agrarreste als Brennmaterial fürs Barbecue.

Als Präsident der Zuse-Gemeinschaft kämpft Ralf-Uwe Bauer für eine stärkere Förderung der Industrieforschung und mehr Aufmerksamkeit für die Bioökonomie.

Mit dem Internetblog „CRISPR-Whisper" und weiteren Veranstaltungen will Susanne Günther das Potenzial der Genschere CRISPR-Cas in die Öffentlichkeit tragen und die Forschung begreifbar machen.

Michael Quintern züchtet Regenwürmer, um mit ihrer Hilfe Bioabfälle in kostbaren Humus zu verwandeln.

Wie hat die intensive Landnutzung die Artenvielfalt in Brandenburg verändert? Dieser Frage geht Jörg Hoffmann im Projekt BioZeit nach.

To-go-Verpackungen die kompostierbar und essbar sind: Frederike Reimold will diese Vision bis 2020 umsetzen und zwar mithilfe von Makroalgen.

Friederike Kögler hat eine Methode entwickelt, mit der Pflanzen lernen, auch mit wenig Wasser auszukommen.

Der Membrantechnologe Matthias Wessling von der RWTH Aachen ist Leibniz-Preisträger 2019. Im Interview erläutert er, wie breit das Anwendungspotenzial von synthetischen Membranen ist und wie sich Industrieprozesse damit nachhaltiger gestalten lassen.

Der Berliner Biologe Michael Ohl will die Vielfalt der Tierarten auf der Erde mithilfe innovativer Technologien erfassen - am neuen Zentrum für integrative Biodiversitätsentdeckung.

Die Nürnberger Bioingenieurin Stephanie Stute entwickelt ein effizientes und kostengünstiges Verfahren zur Herstellung biobasierter und biologisch abbaubarer Kunststoffe aus Polybuttersäure.

Thomas Helle, Geschäftsführer der Tübinger Novis GmbH, entwickelt im Rahmen des EU-Projektes „Smartmushroom“ eine Biogasanlage, die mit Champignonkompost betrieben wird.

Der Kasseler Forscher Stefan Bringezu koordiniert ein Projektkonsortium zum Monitoring der Bioökonomie in Deutschland. Hier werden Werkzeuge entwickelt, mit denen sich der Weg in eine nachhaltige, biobasierte Wirtschaft umfassend messen und bewerten lässt.

Michael Raissig untersucht an der Universität Heidelberg die Funktion der Atmungsporen von Graspflanzen, um deren besondere Effizienz auf andere Kulturpflanzen zu übertragen.

Der Vegetationsökologe Norbert Kühn beschäftigt sich mit der Frage, wie Grünanlagen in den Städten den ökologischen und sozialen Anforderungen gerecht werden können.

Martina Padmanabhan von der Universität Passau untersucht wie die stark industrialisierte Landwirtschaft in Indonesien profitabel und zugleich ökologisch nachhaltig gestaltet werden kann.

Ein Team der Electrochaea GmbH um Francesco di Bari hat ein neuartiges Power-to-Gas-Verfahren entwickelt, das mithilfe von Mikroben die Umwandlung von Strom in Gas und dessen Speicherung noch effizienter macht.

Der Münchner Architekt Ferdinand Ludwig entwirft moderne Baumhäuser. Dabei handelt es sich nicht um Spielzeug für Kinder, sondern um nachhaltige Wohnräume, Klassenzimmer und vieles mehr.

Meeresbiologin Jamileh Javidpour will beweisen, dass Quallen nicht nur Störenfriede sind, sondern auch sinnvoll genutzt werden können.

Der Agrarsystemtechniker Thomas Herlitzius will die Landtechnik revolutionieren. Sein Plan: Ein Schwarm Maschinen soll die Feldarbeit autark erledigen.

Die Bochumer Pflanzenforscherin Ute Krämer untersucht anhand der Hallerschen Schaumkresse, wie anpassungsfähig Pflanzen sind, um selbst auf verseuchten Böden zu wachsen.

Dirk Hebel nutzt ungewöhnliche Baumaterialien wie Pilzfäden, Bambus oder Abfall. Erst kürzlich führte ihn seine Arbeit wieder nach Deutschland, wo er sich für ein Umdenken in der Baubranche einsetzt.