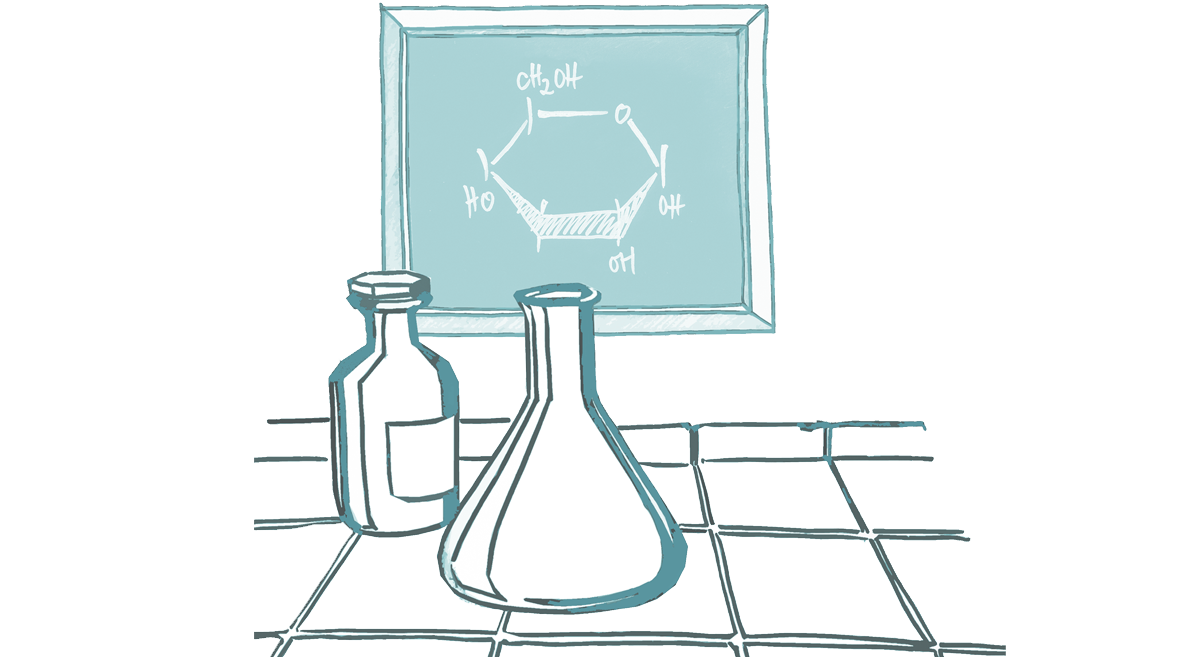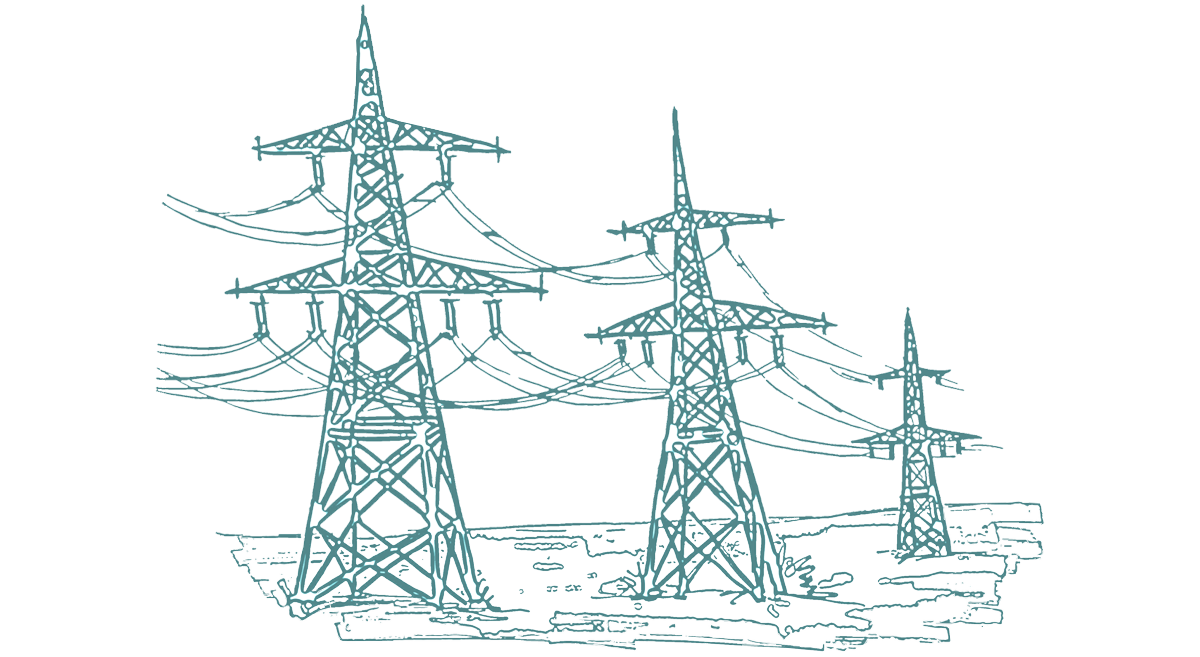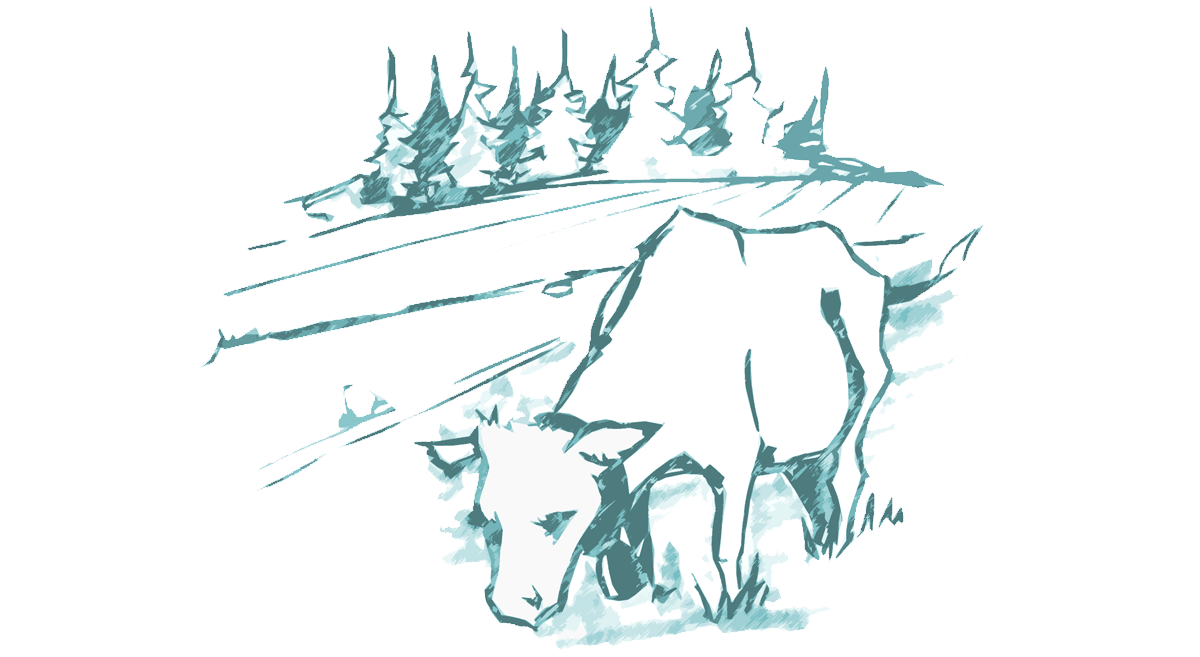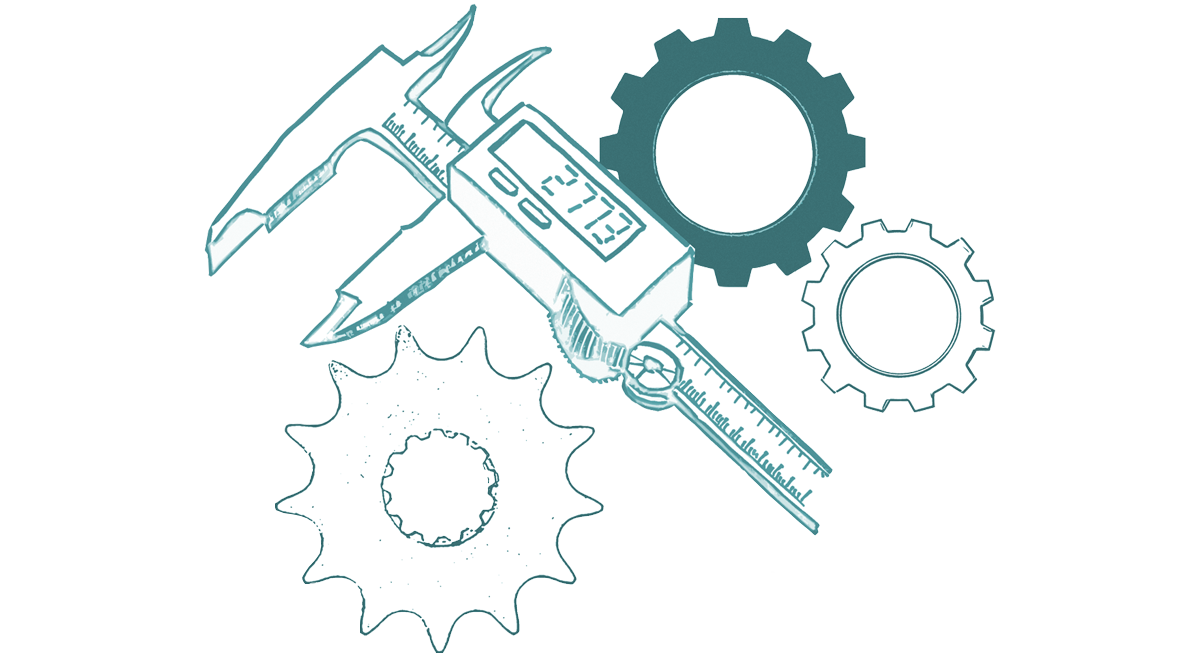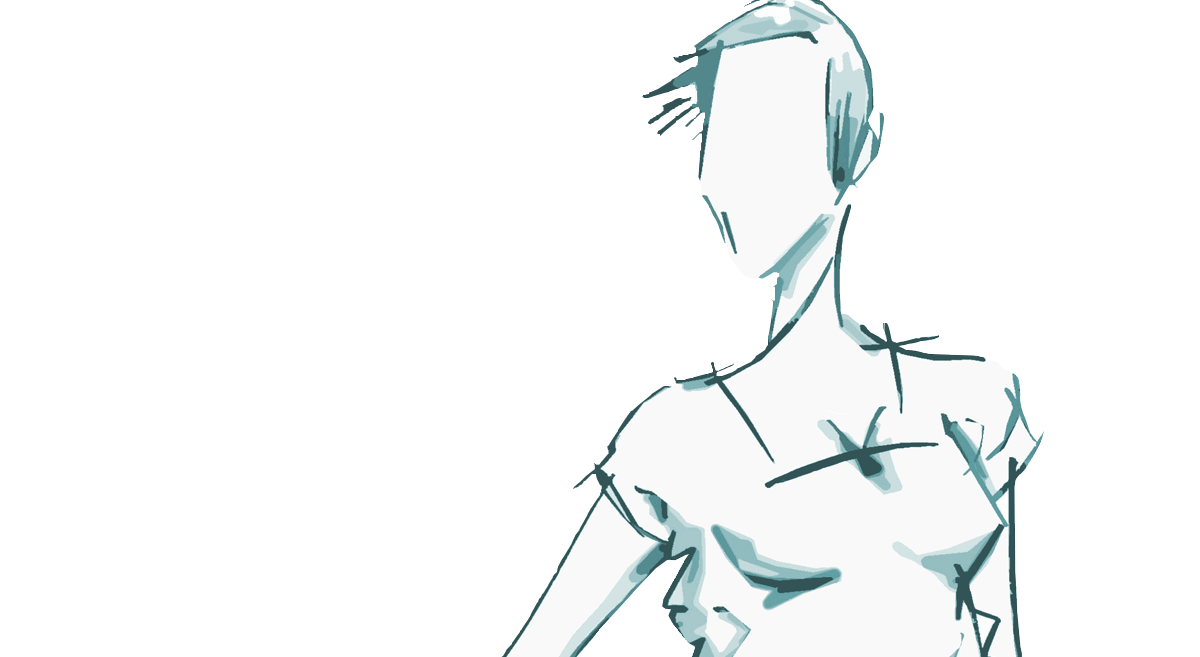Konsumgüter
Ob Kosmetik, Spül- und Waschmittel oder Haushaltsgeräte – bei der Herstellung von Produkten des täglichen Bedarfs kommen schon heute vielfältige biobasierte Verfahren zum Einsatz. Sie ermöglichen innovative Produkte mit neuen Eigenschaften für Verbraucherinnen und Verbraucher. Ein Trendmarkt sind zudem biobasierte Verpackungslösungen.
Beispiele aus der Bioökonomie:
Biobasierte Tenside,
bioaktive Inhaltsstoffe für Kosmetik

Jedes Jahr gibt ein deutscher Haushalt laut Statistischem Bundesamt etwa 31.000 Euro für den privaten Konsum aus. Neben Bekleidung und Lebensmitteln zählen Körper- und Pflegemittel zu den umsatzstärksten Bereichen. In Deutschland wurden im Jahr 2020 mit diesen Produkten rund 14 Mrd. Euro erwirtschaftet. Im Bereich Wasch- und Reinigungsmittel wurden rund 4,6 Mrd. Euro ausgegeben. In der Konsumgüterindustrie hat die Bioökonomie längst ihren Weg in den Alltag gefunden. In vielen Bereichen werden natürliche Rohstoffe oder biobasierte Verfahren im industriellen Herstellungsprozess genutzt.
Im Bereich der Wasch-, Pflege- und Reinigungsmittel ist der Einsatz biobasierter Verfahren schon heute vergleichsweise hoch. Mehr als ein Drittel der hierfür in Deutschland im Jahr 2019 eingesetzten 525.000 Tonnen Inhaltsstoffe werden vollständig oder teilweise biobasiert hergestellt (IKW Nachhaltigkeitsbericht). Dazu gehören Tenside, alkoholische Lösungsmittel, Enzyme oder Zitronensäure. Letztere wird schon heute vollständig biotechnologisch von Schimmelpilzen auf Basis von Melasse produziert – einem Nebenprodukt aus der Zuckerrübenverarbeitung.
Tenside sind als waschaktive Substanzen unverzichtbarer Bestandteil von Putz-, Wasch- und Reinigungsmitteln. Sie werden entweder auf Basis petrochemischer Rohstoffe oder auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt. Mischtenside bestehen sowohl aus petrochemischen als auch biobasierten Rohstoffen. Als nachwachsende Rohstoffe werden hier vor allem Pflanzenöle und tierische Fette genutzt. Zur Tensid-Produktion mittels chemischer Synthese werden hauptsächlich Palmkern- aber auch Kokosöl eingesetzt. Der Kokosölanteil zur Herstellung von Tensiden in Wasch-, Pflege- und Reinigungsmitteln in Deutschland wurde laut Forum Waschen im Jahr 2017 auf 14.000 Tonnen geschätzt. Der Anteil von Palmkernöl wurde vom Forum Nachhaltiges Palmöl im Jahr 2019 mit 75.000 Tonnen angegeben. Um den Prozess umweltfreundlicher zu gestalten, setzen hiesige Hersteller zunehmend auf europäische Ölpflanzen wie Raps, Oliven, Lein und Sonnenblume, oder sie nutzen tropische Öle, die nachhaltig produziert wurden.
Biotenside sind Tensidmoleküle, die in einem biotechnologischen Prozess von Mikroorganismen oder mithilfe von Enzymen hergestellt werden. Biotensiden wird ein großes Marktpotenzial zugemessen, derzeit sind aber nur vereinzelt Produkte auf dem Markt. Zu den Vorreitern bei der Nutzung von Rhamnolipiden, die Bakterien natürlicherweise produzieren, gehört der Spezialchemie-Konzern Evonik. In Karlsruhe gründet das Start-up Biotensidion sein Geschäftsmodell auf die Entwicklung von Biotensiden. Die biotechnologische Herstellung von Biotensiden aus heimischen nachwachsenden Rohstoffen möchte die strategische Allianz „Funktionsoptimierte Biotenside“ forcieren. Das BMBF fördert diese Allianz seit 2018 im Rahmen der Innovationsinitiative Industrielle Biotechnologie über einen Zeitraum von sechs Jahren mit 6,4 Mio. Euro. Forschungseinrichtungen und Unternehmen haben sich zusammengeschlossen, um die gesamte Wertschöpfungskette der Biotensid-Herstellung abzudecken.
Das Konsortium wird von dem Reinigungsmittel- und Kosmetikhersteller Dalli-Werke koordiniert. Zu den Partnern zählen unter anderem BASF, Henkel, Festo und Analyticon Discovery. Ziel der Allianz ist, ein möglichst großes Portfolio verschiedener Biotenside für viele Anwendungsbereiche zu entdecken (etwa Wasch- und Reinigungsmittel, Kosmetik, Pflanzenschutz und Lebensmittel) sowie die Produktivität und Skalierbarkeit der Prozesse auszubauen.
Neben biobasierten Tensiden sind mikrobiell hergestellte Enzyme wesentliche Inhaltsstoffe von Wasch- und Reinigungsmitteln. Auf dieses Segment der Konsumgüterindustrie entfällt der größte Marktanteil (40 %) industrieller Enzyme. Der langjährige Einsatz dieser Biokatalysatoren in Waschmitteln hat einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass der früher extrem energie- und wasserintensive Waschvorgang inzwischen deutlich umweltschonender abläuft. Enzyme sind vielfach bei milden Temperaturen aktiv. Ihnen ist es damit zu verdanken, dass die durchschnittliche Waschtemperatur auf aktuell 46° C gesunken ist. Im Jahr 1972 lag diese noch bei 63° C.
Dagegen machen 90° C-Wäschen heute nur noch 7 % aller Waschvorgänge aus, vor mehr als 40 Jahren waren es noch etwa 40 %. Zugleich hat sich die Effizienz der Waschmittel durch die Biokatalysatoren erhöht: Waren früher noch 220 Gramm für eine 5-Kilogramm-Wäsche notwendig, reichen heute 75 Gramm. Nach Angaben des Industrieverbandes Körperpflege und Waschmittel e.V. wurden im Jahr 2019 rund 7.100 Tonnen Enzyme als Inhaltsstoffe für Wasch- und Reinigungsmittel eingesetzt, 1994 waren es nur die Hälfte.

Bei Körperpflegeprodukten greifen die Hersteller bereits seit längerer Zeit auf spezielle bioaktive Inhaltsstoffe zurück – und bedienen damit eine wachsende Nachfrage nach natürlicher Kosmetik. Laut Statistischem Bundesamt legen 34 % der Deutschen großen Wert darauf, dass Körperpflegeprodukte keine chemischen Zusätze enthalten und auf natürlicher Basis produziert werden. Immer mehr Kosmetikproduzenten gehen auf die Wünsche ihrer Kundschaft ein, indem sie Roh- und Wirkstoffe einsetzen, die aus der Natur stammen, nachhaltig angebaut und geerntet werden können.
In der biotechnologischen Produktion werden Mikroorganismen oder Zellen als lebende Biofabriken eingesetzt. Zu den bioaktiven Inhaltsstoffen, die biotechnologisch entstehen, gehören Peptide, Lipide, Vitamine und Zucker oder Enzyme. Das Zwingenberger Biotechnologie-Unternehmen Brain verwendet Terpene aus Orangenschalen, um daraus mithilfe von Bakterien das Konservierungsmittel Perillasäure zu produzieren. Der Duft- und Aroma-Hersteller Symrise stellte 2018 ein Pentylenglykol vor, das aus dem Nebenprodukt Bagasse der Zuckerrohrverarbeitung hervorgeht. Entwickelt haben die Holzmindener die grüne Alternative zusammen mit dem Leibniz-Institut für Katalyse an der Universität Rostock. Eine weitere vom BMBF geförderte strategische Allianz ist im Bereich biobasierte Kosmetik aktiv: In der strategischen Allianz „GOBI – Good Bacteria and Bioactives in Industry“ werden Forschungserkenntnisse zum gesundheitsförderlichen Einfluss von lebenden Mikroorganismen gebündelt und für die industrielle Anwendung erschlossen. Koordiniert wird der Verbund vom Biotechnologie-Unternehmen Novozymes Berlin (ehemals Organobalance).
Kunststoffe sind zentrale Werkstoffe für die Konsumgüterindustrie. Doch Plastikmüllberge und Mikroplastik in der Nahrungskette haben zur Einsicht geführt, dass Plastikprodukte und -verpackungen inzwischen eine globale Herausforderung darstellen. Immer interessanter werden daher biobasierte und biologisch abbaubare Alternativen (vgl. Chemie). Das gilt für Hersteller von Elektrogeräten ebenso wie für Büro- oder Sportartikelhersteller. Auf Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen hat sich zum Beispiel die Fraunhofer-Ausgründung Tecnaro spezialisiert. Das Unternehmen hat – unter anderem unterstützt vom BMBF – den thermoplastischen Biokunststoff Arboform entwickelt. Aus dem „flüssigen Holz“ lässt sich eine breite Produktvielfalt herstellen, darunter sind Spielfiguren oder Aufbewahrungsboxen. Gefördert vom BMEL hat das Unternehmen FKuR Kunststoff gemeinsam mit mehreren Forschungseinrichtungen neue biobasierte Hart-Weich-Verbundmaterialien entwickelt, die im Mehrkomponentenspritzguss zu Büro-, Hygiene- und Sportartikeln sowie Griffen und Gehäusen verarbeitet werden können. Die Hartphase besteht dabei aus Celluloseacetat (CA) und Polymilchsäure (Polylactid – PLA). Für die Weichphase wurden thermoplastische Elastomere (Bio-TPE) und biobasierter Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (Bio-EPDM) verwendet.

Neue Kunststoff-Richtlinien in der EU und entsprechende Gesetze auf nationaler Ebene, aber auch die kritischere Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten führen dazu, dass die Unternehmen ihre Verpackungsmaterialien hinsichtlich Recycling, Wiederverwertbarkeit und Nachhaltigkeit optimieren. Gerade im Lebensmittel- oder im Pharmabereich sind die Anforderungen an Verpackungen sehr hoch: Sie müssen nicht nur stabil sein, sondern auch die Ware vor Schmutz, Feuchtigkeit und mikrobiellen Kontaminationen schützen und zudem am besten auch recycelbar sein. Um diese Anforderungen auch mit biobasierten Kunststoffen umsetzen zu können, fördert das BMEL mehrere anwendungsnahe Forschungsansätze. Im Projekt BioPrima entwickelt die Südzucker AG mit Partnern eine stärkebasierte Schrumpffolie für Gefrieranwendungen. Ein biobasiertes und recyclinggerechtes Verpackungskonzept für sensible Lebensmittel, die unter einer Schutzgas-atmosphäre verpackt werden, sucht das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV) zusammen mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Das Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC entwickelt mit Industriepartnern biobasierte Hochleistungsbarrierefolien, die zu 95 bis 100 % biobasiert und recyclingfähig sind.
In der Industrie werden derzeit papierbasierte Verpackungen stark nachgefragt. Auch zwei Projekte der BMBF-Fördermaßnahme „Ideenwettbewerb: Neue Produkte für die Bioökonomie“ entwickeln hierzu innovative Lösungen. Die „BioBox“ ist eine gewickelte Verpackung, die ganzheitlich aus Papier besteht. Die notwendigen Barrieren zum Schutz des Produkts werden durch ein spezielles und innovatives Papier realisiert. In einem anderen Ideenwettbewerb-Projekt werden thermoformbare Papierwerkstoffe erprobt, um damit dreidimensionale Strukturen zu fertigen. Als Alternative zum Holz als Rohstoff haben einige Unternehmen Fasern aus Gras für die Papierherstellung erschlossen. Auch Agrarreststoffe kommen als Faserquelle infrage. Das Cleantech-Start-up BIO-LUTIONS aus Hamburg und die Zelfo Technology GmbH gewinnen in einem mechanischen Verfahren aus Weizen-, Rapsstroh, Schilf oder Gemüsestängeln einen Faserbrei, der sich in vielfältige Formen pressen lässt, etwa für Verpackungen und Essgeschirr. Derzeit wird im brandenburgischen Schwedt eine Produktionsstätte errichtet.