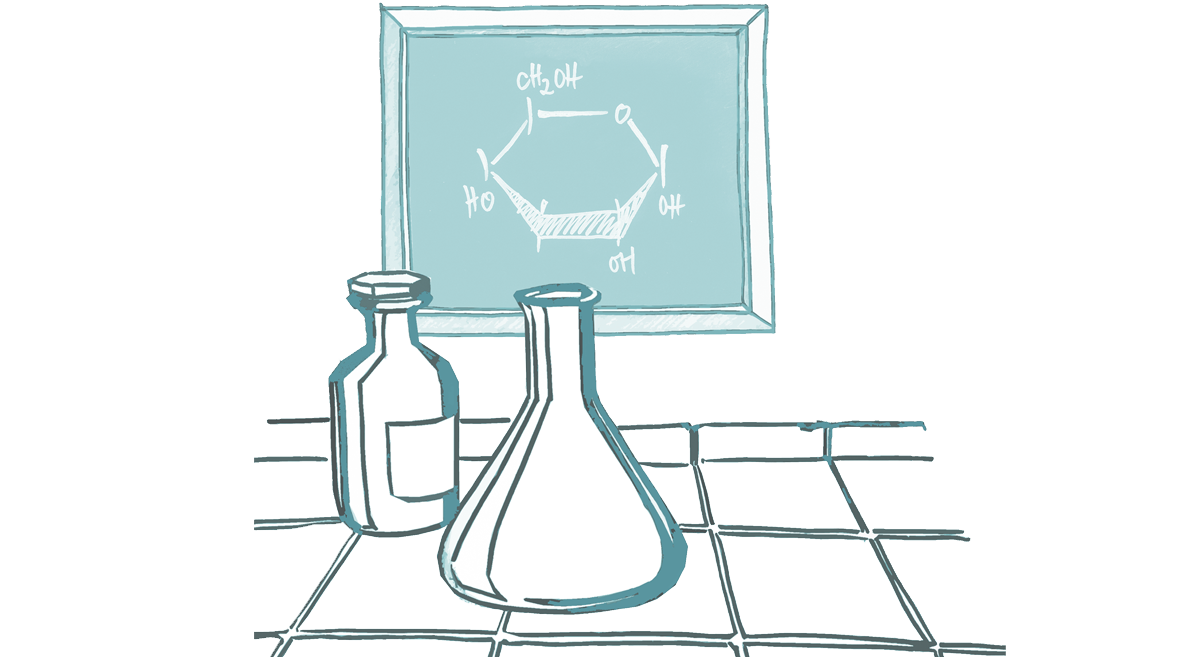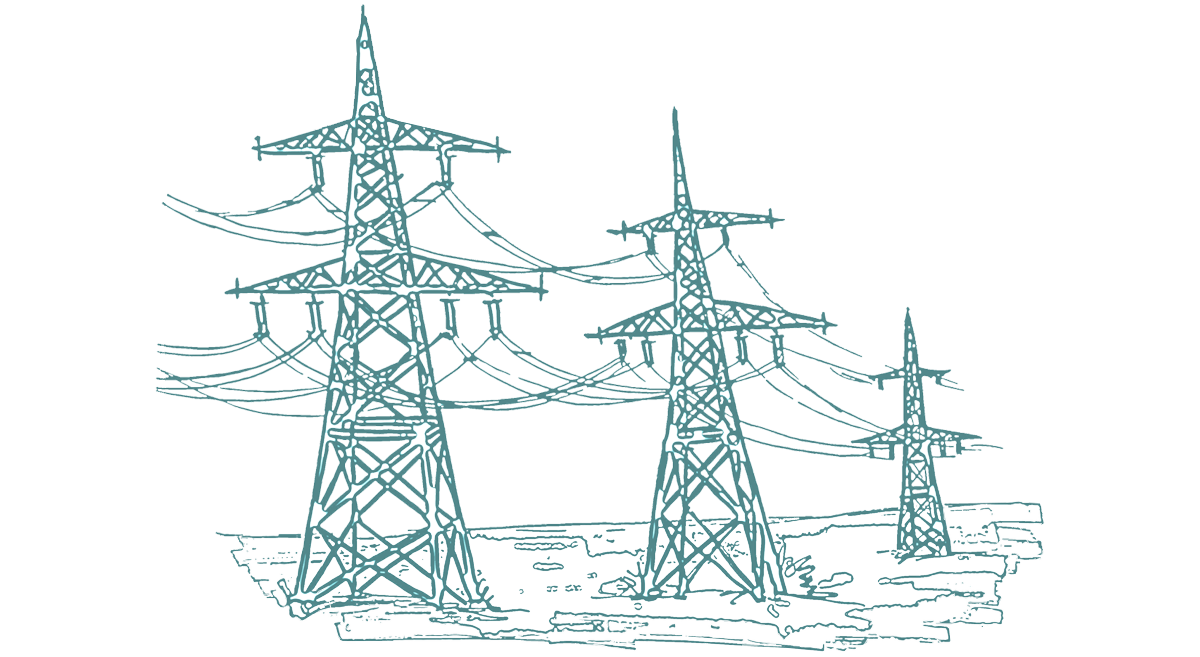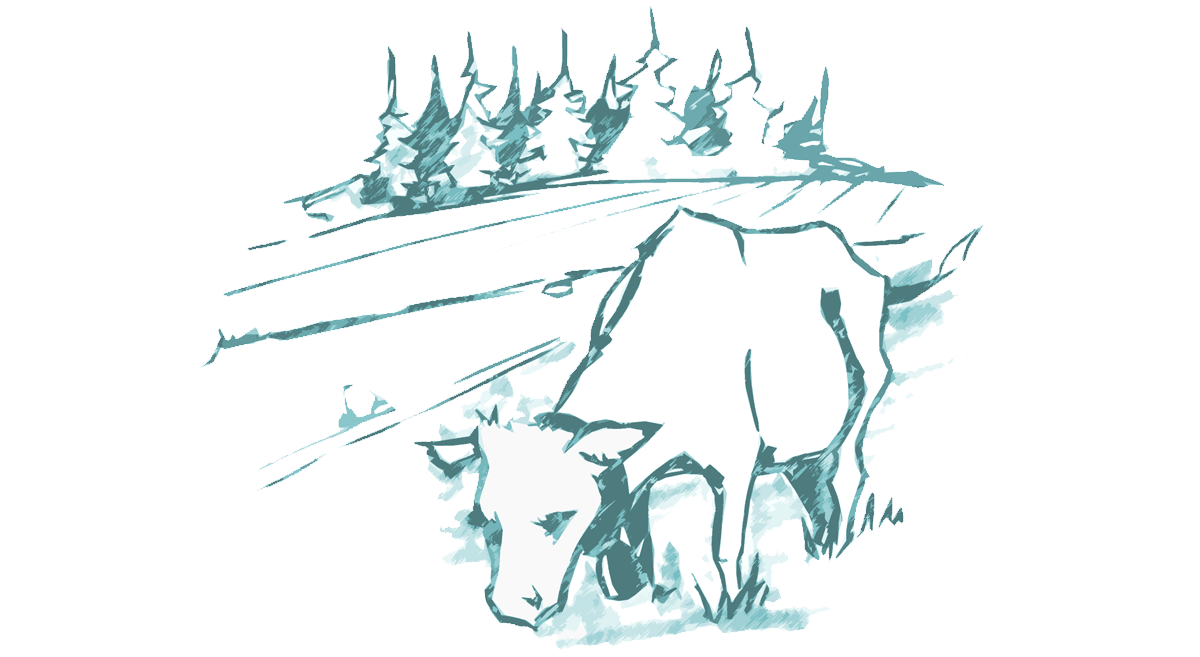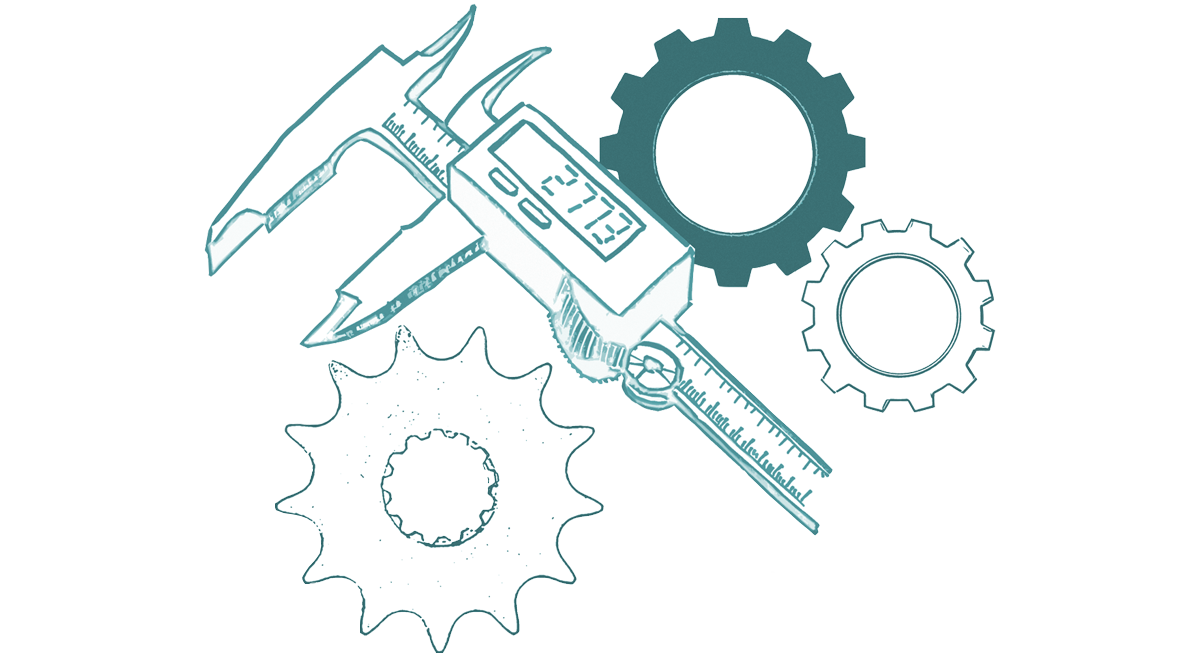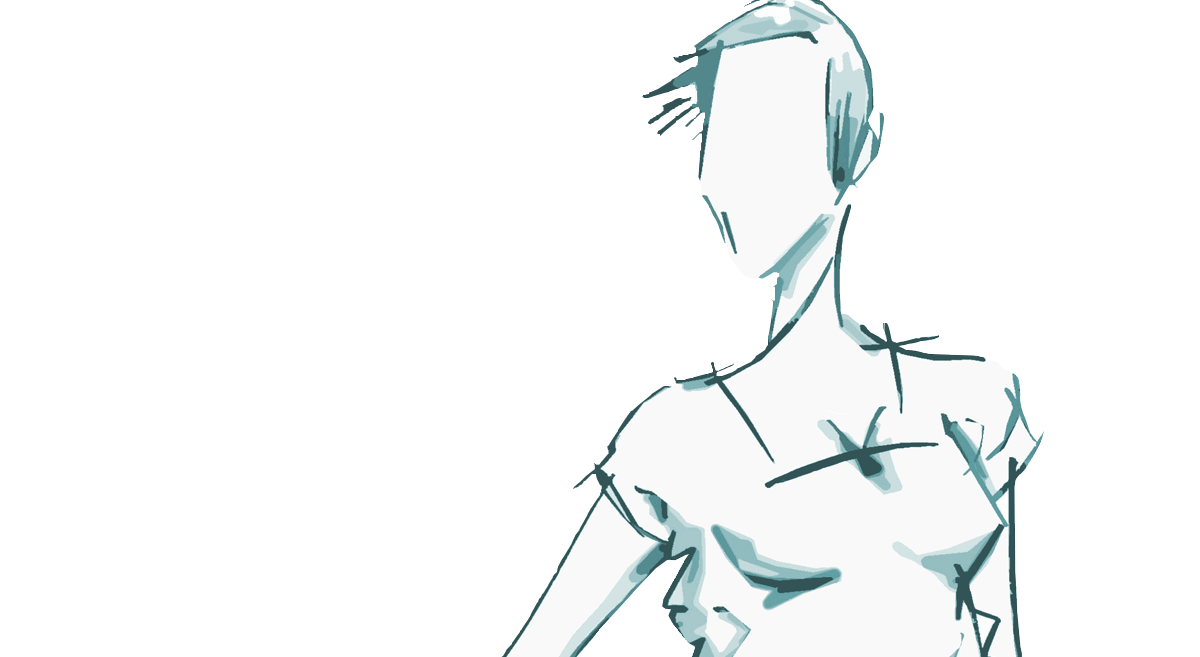Bau
Ob als Baumaterial und Werkstoff, zur Dämmung oder beim Innenausbau: Nachwachsende Rohstoffe können mit guten Materialeigenschaften punkten, verbessern die Ökobilanz und sind oftmals gesundheitsverträglicher. Aber auch für konventionelle Produkte der Baubranche – wie Beton – gibt es inzwischen biobasierte, nachhaltige Strategien.
Beispiele aus der Bioökonomie:
Holzbau,
naturfaserverstärkte Verbundwerkstoffe,
Biodübel

Der Bausektor ist einer der rohstoffintensivsten Wirtschaftsbereiche in Deutschland. 90 % aller verwendeten mineralischen Rohstoffe werden zur Herstellung von Baustoffen und -produkten eingesetzt. Der Gebäudesektor ist in Deutschland für etwa 40 % der gesamten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Drei Viertel davon machten allein Nutzung und Betrieb aus, den Rest trugen Baustoffindustrie und Bauwirtschaft bei. Das verrät der Umweltfußabdruck von Gebäuden, den das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung ermittelt hat. Mit Blick auf Klimaneutralität und Nachhaltigkeit rücken biobasierte Materialien verstärkt in den Fokus.
Damit sind die Branchen Bauhauptgewerbe und Ausbaugewerbe mit ihren rund 325.000 Betrieben und 2 Mio. Beschäftigten im Jahr 2019 hierzulande auch für die Bioökonomie von großer Bedeutung. Mit 277 Mrd. Euro erbringt die Branche nominal etwa 6 % der gesamten Wertschöpfung in Deutschland. Allein auf den Holzbau entfielen 2020 laut Zentralverband des Deutschen Baugewerbes 71.561 tätige Personen in 11.864 Betrieben. Ihr Gesamtumsatz betrug 8,3 Mrd. Euro.
Holz ist der wichtigste nachwachsende Bau- und Werkstoff. Entweder wird klassisch Schnittholz aus den Sägewerken eingesetzt oder aber Holzwerkstoffe. So werden exemplarisch bei der Herstellung von Spanplatten Holzspäne miteinander verleimt und in Form von Platten gepresst. Holz besitzt sehr gute bauphysikalische Eigenschaften: Es ist nicht nur flexibel, leicht und gut zu bearbeiten, sondern auch tragfähig, druckstabil und in verarbeiteter Form äußerst biegefest. Hinzu kommt der Klimaschutzaspekt: Während des Wachstums nehmen Bäume Kohlendioxid auf und speichern den Kohlenstoff in ihrer Holzbiomasse – Holz wirkt als natürlicher CO2-Speicher. Für die Herstellung und Entsorgung von Baustoffen aus Holz ist in der Regel weniger fossile Energie notwendig als für Materialien auf Basis endlicher, mineralischer Rohstoffe.
Durch seine angenehme Oberflächentemperatur und die Fähigkeit, die Luftfeuchtigkeit in Gebäuden zu regulieren, trägt es zu einem guten Wohnklima bei. Aus Holz können Konstruktionen hergestellt werden, die sich nicht nur für den Neubau, sondern insbesondere auch für die Nachverdichtung oder die Aufstockung bestehender Gebäude eignen. Holzkonstruktionen können effizient in Werken vorgefertigt werden, was zu hoher Genauigkeit und Bauzeitverkürzung führt.
Digitalisierte Planung und Fertigung
Die Holzbauquote lag im Jahr 2023 laut dem Verband Holzbau Deutschland bei 22 %. Die Anzahl der Beschäftigten im Bereich des Bauens mit Holz stieg innerhalb von zehn Jahren um 28 %. Mit dem Ziel der Förderung des Holzbaus beschäftigt sich im Rahmen der vom BMEL initiierten „Charta für Holz 2.0“ insbesondere die Arbeitsgruppe „Bauen mit Holz in Stadt und Land“ mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung.
Immer öfter wird Holz von Architekten als tragende Konstruktion verbaut. Mit dem vom BMEL ausgelobten Bundeswettbewerb HolzbauPlus werden besondere Glanzstücke dieser Bauweise ausgezeichnet. Ein eindrucksvolles Beispiel für einen modernen Hightech-Holzbau ist der von der Universität Stuttgart für die Bundesgartenschau 2019 entworfene BUGA-Pavillon: Die tragende Struktur des Pavillons, vom Plattenskelett der Seeigel inspiriert, besteht ausschließlich aus Faserverbundwerkstoffen. Der Leichtbau wurde computerbasiert entworfen und in einem robotergestützten Prozess gefertigt. 2020 wurde das Konzept im Bundeswettbewerb HolzbauPlus ausgezeichnet. In einem vom BMEL geförderten Digitalisierungsprojekt unter der Leitung der TU München wird eine 3D-basierte Planungsmethode aus dem Hochbau für den industrialisierten Holzbau weiterentwickelt und nutzbar gemacht – das sogenannte Building Information Modeling (BIM). Das System unterstützt digitale Arbeitsabläufe aller Akteure, die im Planungs- und Bauprozess eingebunden sind.

Das Potenzial von Laubholz erschließen
Tragende Bauteile werden im Holzbau vorwiegend aus Nadelhölzern wie Fichte hergestellt. Doch die Blicke der Forschung und Entwicklung im Bauwesen richten sich zunehmend auf Laubholz. Einer der Gründe: In den heimischen Wäldern, die in Anpassung an den Klimawandel zu Mischwäldern umgebaut werden, ist Buchenholz reichlich vorhanden und der Vorrat wird voraussichtlich weiter anwachsen. Aktuell wird Laubholz überwiegend energetisch genutzt. Durch die Möglichkeiten moderner Klebetechnologien lässt sich das Potenzial von Laubholz jedoch weiter erschließen: Die auf Buchenholz spezialisierte Sägefirma Pollmeier hat zum Beispiel den Holzwerkstoff Baubuche entwickelt. Für diesen neuartigen Werkstoff wird Holz vom Buchenstamm geschält und dann lagenweise zu sogenanntem Furnierschichtholz übereinandergeleimt.
So entsteht ein Hightech-Material, das sich für den konstruktiven Holzbau einsetzen lässt. Das besonders dichte Furnierschichtholz besitzt ein Tragverhalten, das annähernd dem von Stahl gleicht. Das lässt sich im Schraubenwerk des Herstellers SWG in Waldenburg besichtigen: Dort wurde das weltgrößte Dachtragewerk aus Baubuche errichtet. Es überspannt eine Fläche von 97 Meter auf 114 Meter. Das Thünen-Institut für Holzforschung analysiert die bauphysikalischen Eigenschaften von Baubuche.
Zum Thema Laubholz gibt es inzwischen mehrere innovative Initiativen von Bund und Ländern, die das Holz von Buche, Eiche und Co für den Bau, aber auch für andere Branchen erschließen wollen. Dazu zählt das Technikum Laubholz in Baden-Württemberg. Zudem fördert das BMEL Forschungsprojekte zur Steigerung der stofflichen Verwendung von Laubholz, unter anderem auch im Rahmen der Charta für Holz 2.0.
Bauen mit Holz ist nicht die einzige Möglichkeit, die CO2-Emissionen in der Baustoffindustrie zu senken. Stahl- und Zementindustrie stoßen enorme Mengen an CO2 aus. Schon jetzt ist es möglich, Stahl in Beton durch ein Gewebe aus Flachsfasern zu ersetzen, wie das Fraunhofer-Institut für Holzforschung (WKI) in Braunschweig demonstriert hat. Im Vergleich zu einer Brücke aus Stahlbeton könnte die Dicke des Materials im Flachsbeton mindestens halbiert werden. Zu Beton selbst gibt es eine Reihe von Forschungsvorhaben, die durch biobasierte Rohstoffe, bessere Recyclingquoten und weitere Ansätze die Klimabilanz aufbessern wollen. Forschende in Berlin haben beispielsweise einen Biobeton auf Basis von Maniokschalen entwickelt.
Ein Team der Hochschule München mischt seiner Betonrezeptur Bakterien bei. Entstehen Risse und dringt Feuchtigkeit ein, bilden die Mikroorganismen Kalkstein und reparieren so den Riss. Das verlängert die Lebensdauer der Bauwerke. Nicht zuletzt lassen sich Holz und Beton auch zu sogenannten Hybrid-Materialien verbinden. Ein vom BMEL gefördertes Forschungsprojekt verwendet eine innovative Nass-in-Nass-Verklebungstechnologie, bei der frischer Beton auf eine noch feuchte Klebstoffschicht auf einem Holzträger aufgegossen wird. Auf diese Weise verklebte Holz-Beton-Verbund (HBV)-Decken sind tragfähiger als herkömmliche HBV-Decken und sparen gegenüber üblicher Bauweisen zwei Drittel des Betons und vier Fünftel des Bewehrungsstahls. Die CO2-Emission sinkt so auf ein Drittel.
An der TU Berlin setzen Forschende auf Pilze, die nachwachsende Rohstoffe in innovative Baumaterialien verwandeln können. Ständerpilze sind für die Herstellung von Verbundwerkstoffen am besten geeignet. Dabei kann es sich um essbare Pilze handeln wie Austernpilze oder um Baumpilze wie den Zunderschwamm. Die Pilzmyzelien wandeln pflanzliche Reststoffe in einen stabilen und gleichzeitig sehr leichten Verbundwerkstoff um. Großes Plus: Die Bauteile können leicht kompostiert werden. Fachleute für nachhaltiges Bauen vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) beschäftigen sich mit „kultivierten“ Baustoffen aus Pilzmyzelien und wie sie sich mit digitalen Fabrikationstechniken kombinieren lassen.

In einer Ära des energieeffizienten Bauens und Sanierens gewinnen Naturdämmstoffe zunehmend an Bedeutung – ihre Herstellung benötigt weniger Energie und sie haben einen positiven Einfluss auf das Wohnklima. Sie können zudem große Mengen an Feuchtigkeit aufnehmen und sind vielfach allergikerfreundlich. 2019 lag der Marktanteil von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen bei ca. 9 %. Den größten Anteil in diesem Segment haben mit 58 % die Holzfaserdämmstoffe. Auch Cellulose aus zerfasertem Altpapier dient als Ausgangsmaterial und macht 32 % der biobasierten Dämmstoffe aus. Hinzu kommen Hanf, Flachs, Wiesengras und Stroh sowie Schafwolle. Agrarreststoffe können eine weitere Grundlage sein, wie ein vom BMBF gefördertes Projekt erforscht hat. Darin wurden Schütt- und Einblasdämmstoffe entwickelt, die aus Maisspindeln erzeugt werden, den inneren harten Teil des Maiskolbens, der bei der Gewinnung von Körnermais übrigbleibt. Der Marktanteil von Naturfarben lag im Jahr 2018 bei 5 %. Anders als konventionelle chemische Produkte werden Naturfarben aus natürlichen mineralischen oder pflanzlichen Quellen hergestellt und kommen mit weit weniger Lösungsmittel aus. Zu den wichtigsten Naturfarben-Produkten zählen Wandfarben, Holzlasuren, Naturharzlacke, Öle und Wachse. Bodenbeläge aus nachwachsenden Rohstoffen liefern die Basis für Holzfußböden wie Parkett, Dielen oder Laminat, aber auch für Kork- und Sisalböden. Linoleum besteht hauptsächlich aus Leinöl, Kork- und Holzmehl, Kalkmehl und Pigmenten sowie Jutegewebe als Trägerschicht.
Auf dem Weg in eine Kreislaufwirtschaft ist auch für die Bauwirtschaft das Thema Recycling von großer Bedeutung. Eine vom BMBF geförderte deutsch-chinesische Forschungskooperation namens ReMatBuilt zielt darauf ab, die Ressourceneffizienz im Bauwesen zu verbessern, indem Land- und Forstwirtschaftsabfälle sowie Bau- und Abbruchabfälle verwertet werden. Gemeinsam werden umweltfreundliche Hybrid- und Bauprodukte entwickelt, beispielsweise Dämmplatten aus Reis- und Weizenstroh.