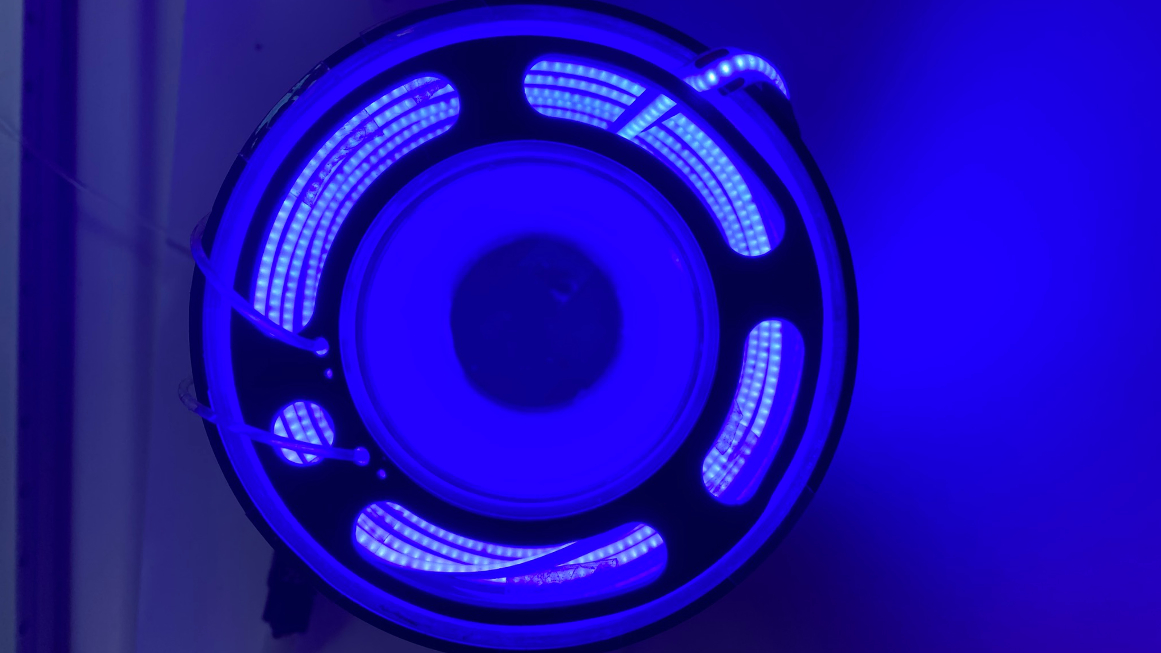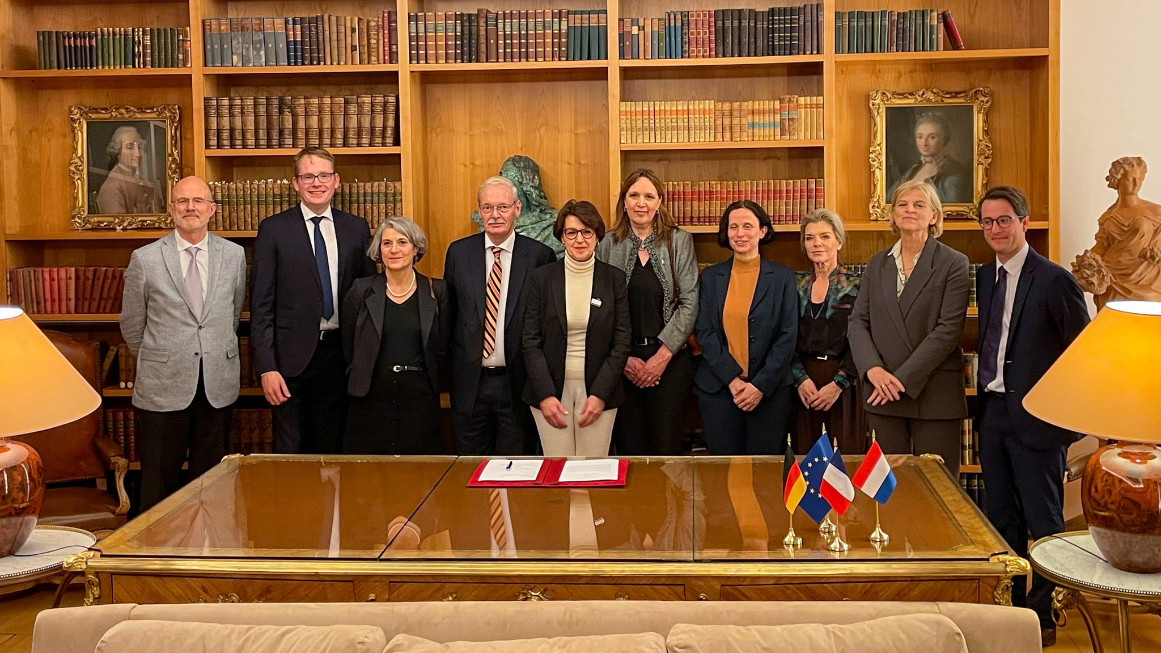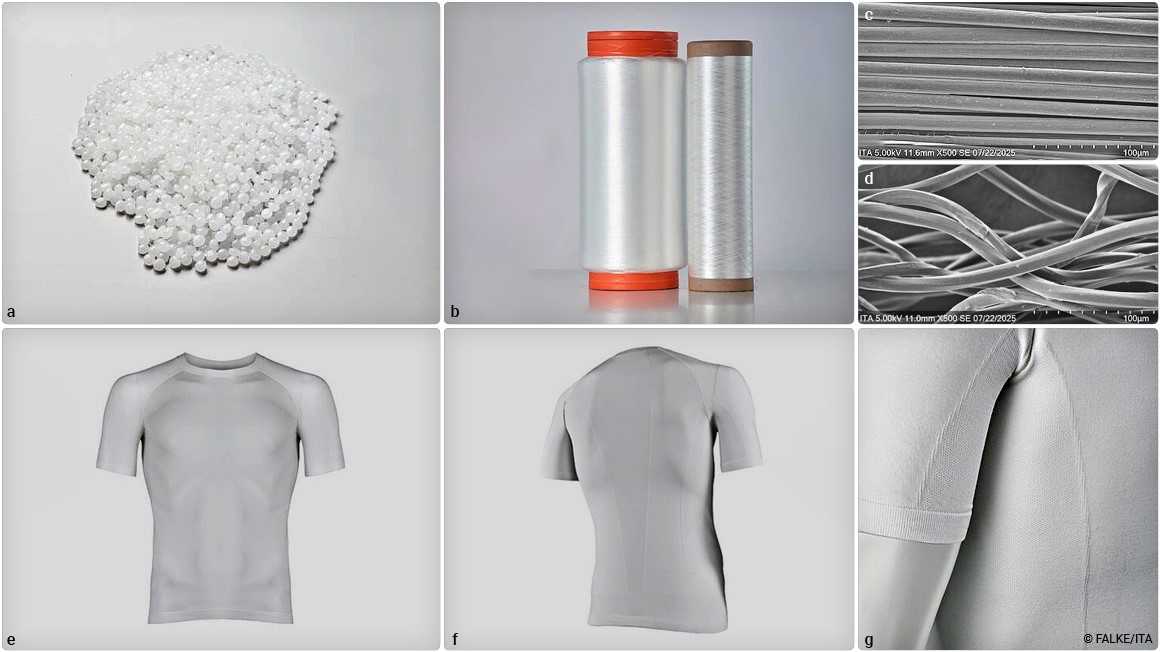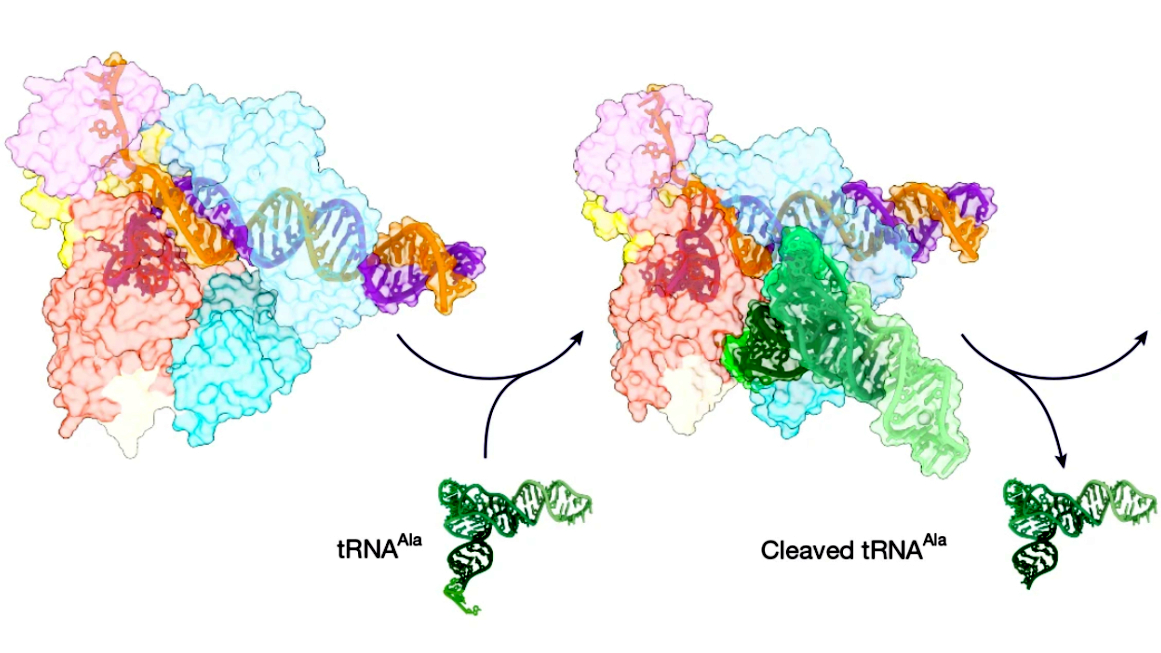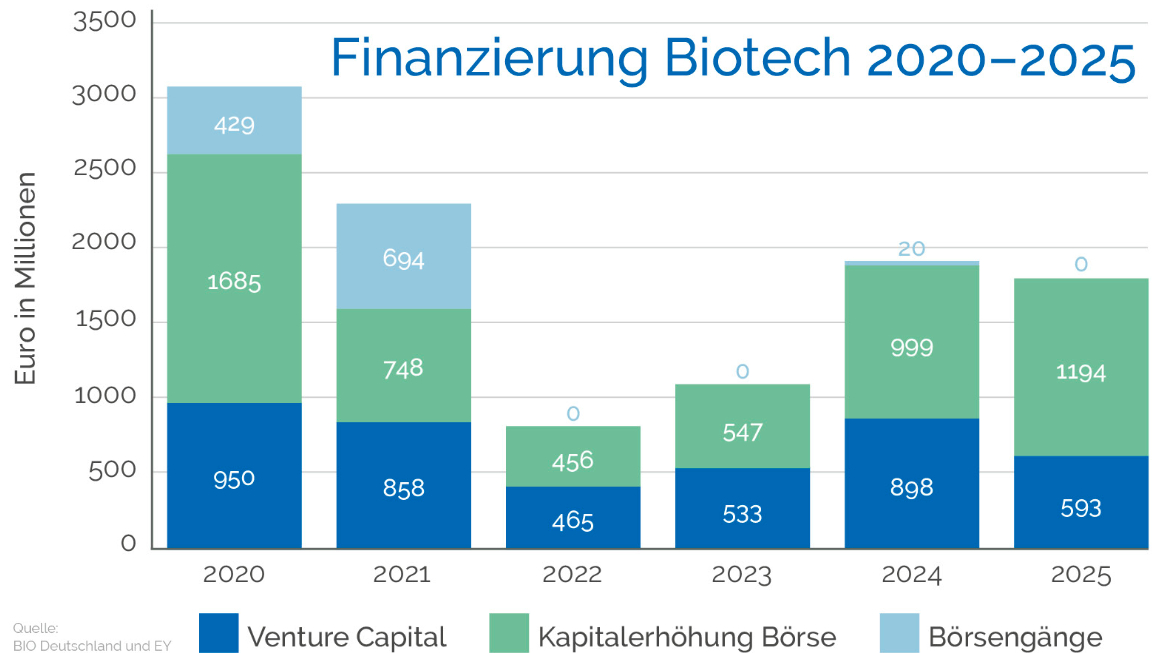Welche Faktoren die Entscheidung für Bio-Dämmstoffe beeinflussen
Eine aktuelle Untersuchung zeigt, dass Wissen über biobasierte Dämmstoffe und positive Rückmeldungen aus dem Umfeld entscheidend dafür sind, ob diese in privaten Haushalten eingesetzt werden. Staatliche Förderungen helfen oft weniger als gedacht.