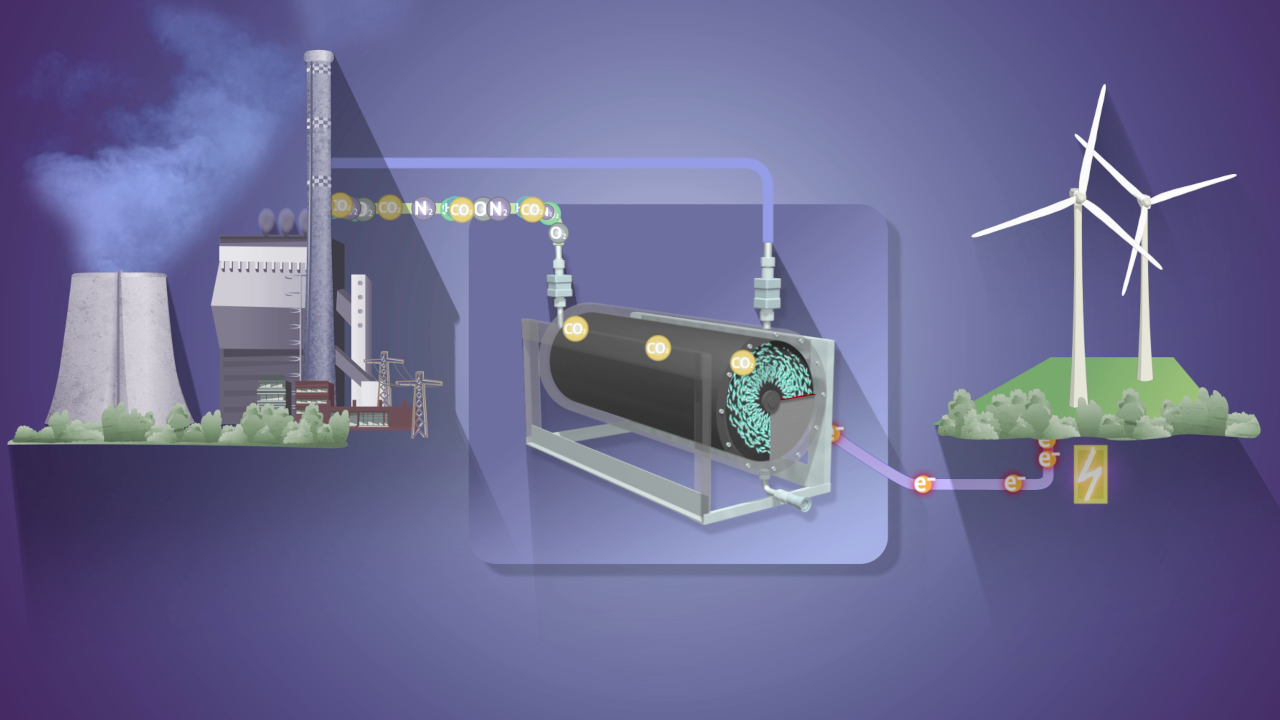Nachhaltige Batterien aus Holzabfällen
Forschende des Fraunhofer IKTS und der Friedrich-Schiller-Universität Jena entwickeln gemeinsam mit Industriepartnern eine neue Generation von Natrium-Ionen-Batterien auf Basis von Lignin.

Leistungsfähige Stromspeicher sind die Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende. Doch herkömmliche Batterien benötigen bestimmte Metalle, deren Abbau für Mensch und Umwelt schädlich ist. Eine vielversprechende Alternative sind daher Natrium-Ionen-Batterien, die aus lokal verfügbaren und umweltfreundlichen Rohstoffen hergestellt werden. Im Projekt ThüNaBsE entwickeln Forschende des Fraunhofer IKTS und der Friedrich-Schiller-Universität Jena nun einen solchen nachhaltigen Energiespeicher.
Natrium-Ionen-Batterie aus Holzabfällen
Das Team nutzte dafür Lignin, ein Hauptbestandteil von Holz, das als Nebenprodukt in der Papier- und Zellstoffindustrie anfällt. Mithilfe des Biopolymers soll eine neuartige und zugleich kostengünstige, sichere und ressourcenschonende Natrium-Ionen-Batterie entstehen, die ohne kritische Rohstoffe auskommt. „Wir wollen in der Wertschöpfungskette auf kritische Metalle wie Lithium, Kobalt und Nickel in Batterien verzichten. Zudem möchten wir den Fluoranteil in Elektroden und Elektrolyt möglichst niedrig halten und erproben, inwiefern er sich komplett vermeiden lässt“, sagt Lukas Medenbach, Wissenschaftler am Fraunhofer IKTS in Arnstadt.
Hard Carbon aus Lignin als Elektrodenmaterial
Den Forschenden zufolge wird das Lignin zu sogenanntem Hard Carbon verarbeitet und als Material für die negative Elektrode eingesetzt. Dafür soll vor allem lokal verfügbares und hochwertiges Lignin als Elektrodenmaterial verwendet werden. Für die positive Elektrode werden wiederum ungiftige Eisenverbindungen genutzt.
Einsatz als stationäre und mobile Energiespeicher
Erste Tests der Demonstratorzellen verlaufen den Forschenden zufolge vielversprechend: Nach 100 Ladezyklen zeigen die Prototypen kaum Leistungseinbußen. Bis Projektende soll eine 1-Amperestunden-Zelle 200 Zyklen erreichen. Perspektivisch könnten die Batterien als stationäre Speicher oder in mobilen Anwendungen mit geringem Leistungsbedarf – etwa in Microcars oder Gabelstaplern – eingesetzt werden.
Das Projekt ThüNaBsE wird vom Freistaat Thüringen und dem Europäischen Sozialfonds gefördert. Nach Abschluss ist eine Skalierung der Technologie und der Übergang zu höheren Reifegraden geplant.
bb