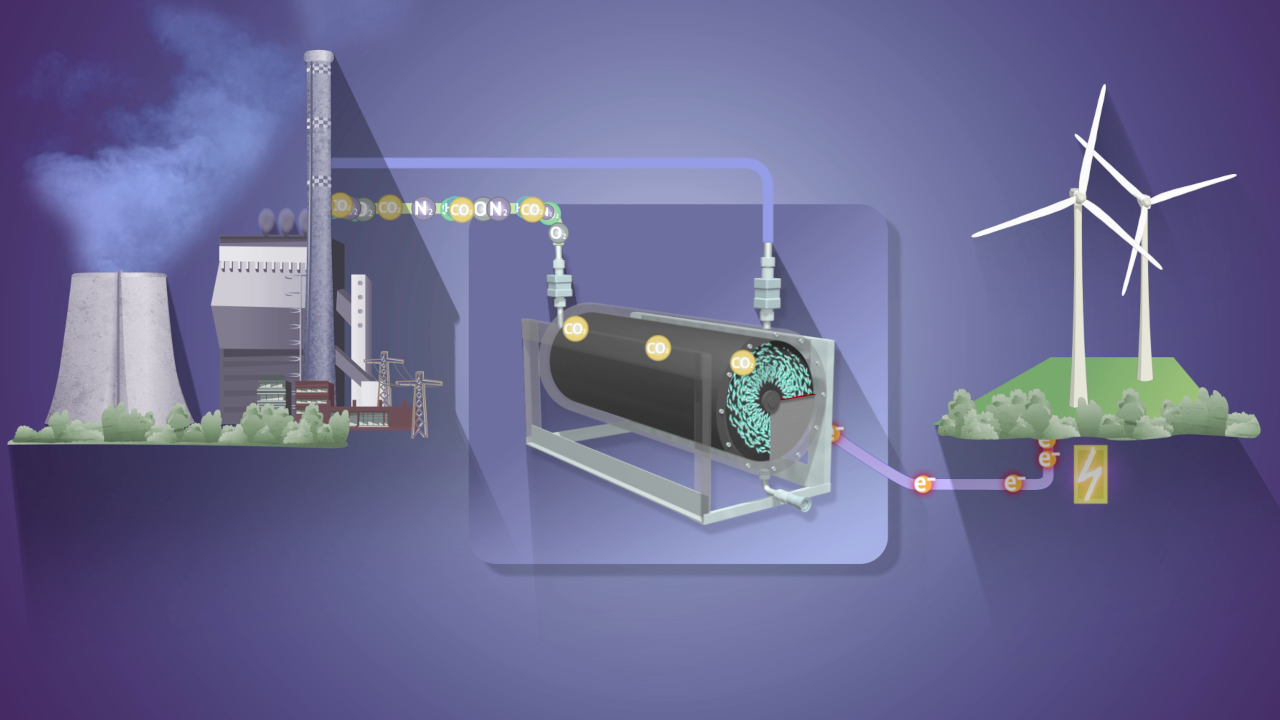Rotorblätter aus Flachsfasern
Kieler Forschende wollen in den kommenden zwei Jahren Rotorblätter für Kleinwindanlagen aus nachwachsenden Rohstoffe entwickeln und zeigen, dass die nachhaltige Alternative auch die technischen Anforderungen erfüllt.

Rotorblätter von Windkraftanlagen verursachen jedes Jahr zehntausende Tonnen Abfall, da die Entsorgung ein Problem ist. Durch den Rückbau älterer Anlagen werden sich die Abfallmengen in den nächsten Jahren vervielfachen. Das Problem: Rotorblätter bestehen in der Regel aus glas- und kohlefaserverstärkten Kunststoffen, deren Herstellung kosten- und energieintensiv ist. Ein Forschungsteam der HAW Kiel will das ändern: Im Projekt untersucht die Hochschule gemeinsam mit einem Unternehmen aus dem Yachtbau, ob nachwachsende Rohstoffe wie Flachsfasern, Balsaholz oder Paulownia eine umweltfreundliche Alternative bieten.
Rotorblätter aus Flachsfasern für eine nachhaltige Energiewende
„Wir möchten zeigen, dass nachhaltige Rotorblätter aus Flachsfasern und anderen nachwachsenden Rohstoffen sämtliche technischen Anforderungen erfüllen können und so einen echten Beitrag für eine noch nachhaltigere Windenergie leisten“, erklärt Projektleiter Sten Böhme von der HAW Kiel.
Prototyp für Kleinwindanlagen
In den kommenden zwei Jahren will das Projektteam einen funktionsfähigen Prototyp für Kleinwindanlagen mit einer Rotorfläche unter 200 Quadratmetern bauen. In Simulationen, Materialtests und Windkanalversuchen sollen neue Bauweisen entwickelt und deren Belastbarkeit nach DIN-Norm geprüft werden.
Durchbruch für breite Anwendung
Im Vorfeld hatte der Projektpartner Nuebold Yachtbau GmbH bereits verschiedene Proben aus Flachsfasern getestet und sie auf ihre Belastbarkeit und Stabilität geprüft. „Wir sind überzeugt davon, dass insbesondere Erkenntnisse zu den dynamischen Materialeigenschaften den Durchbruch in der breiten Anwendung ermöglichen können“, erklärte deren Geschäftsführer Jaron Nübold.
Das Projekt ist im Oktober gestartet und wird bis September 2027 mit rund 175.000 Euro von der Gesellschaft für Energie- und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EKSH) gefördert.
bb