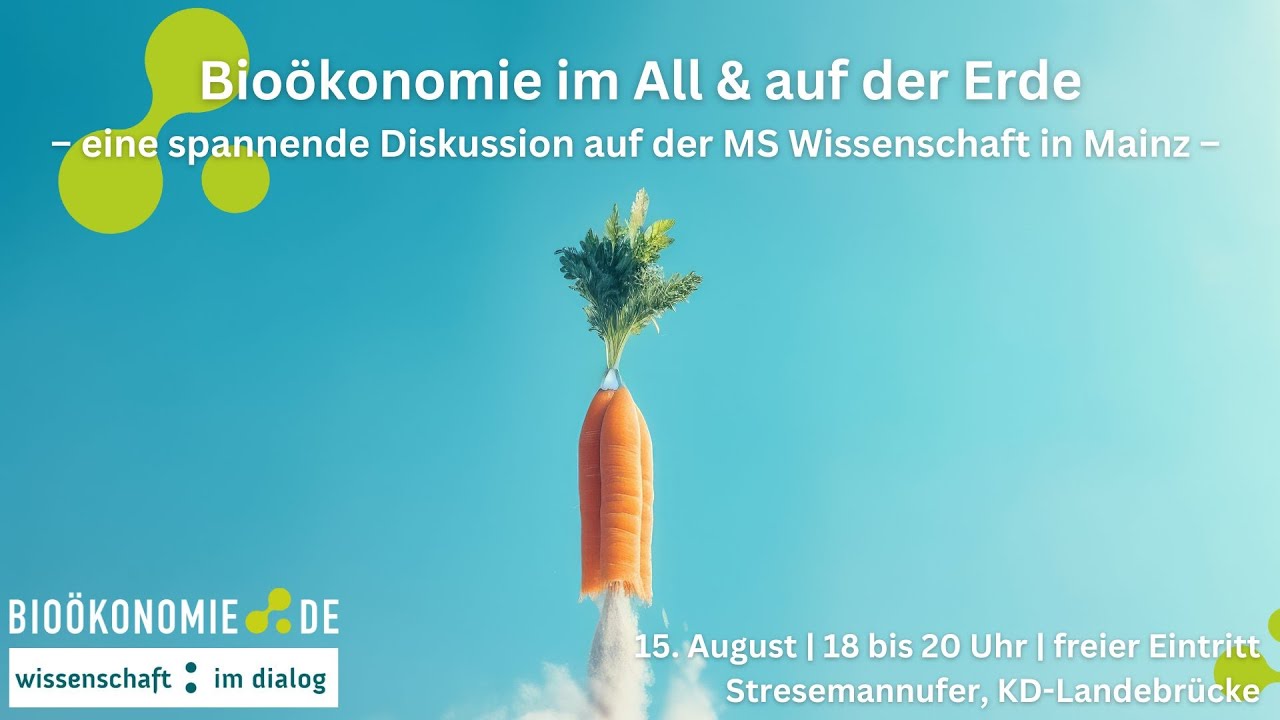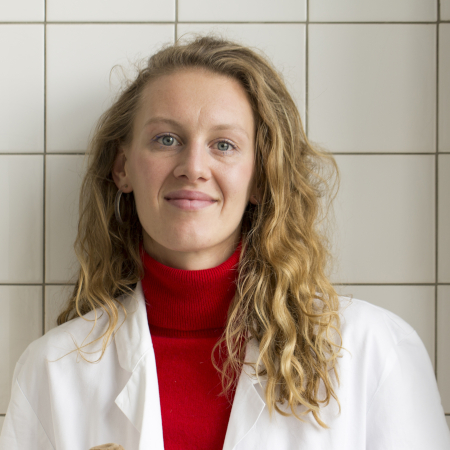Cannabinoide Substanzen – das klingt im Kontext der aktuellen Teillegalisierung von Cannabis irgendwie nach Rauschmitteln. Doch viele der rund 120 bekannten Cannabinoide sind potente Schmerzmittel, darunter auch Delta-9-THC (Dronabinol), das Ärzte sehr spezifisch bei bestimmten chronischen Schmerzen verschreiben. Weil die bisher übliche chemische Synthese nicht unproblematisch ist, suchen Forschende im Projekt BigPharm nach nachhaltigen biotechnologischen Alternativen.
Im ersten Moment klingt die chemische Synthese gar nicht schlecht: Immerhin beginnt sie mit einem biobasierten Reststoff, Limonen, das bei der Herstellung von Orangensaft als Nebenprodukt anfällt. „Limonen ist sehr billig. Aber man muss es oxidieren zu Menthadienol. Das geht nur sehr schlecht und es fallen viele toxische Nebenprodukte an“, erläutert Projektleiter Norbert Mehlmer von der TU München. Die Nebenprodukte müssen mit teils problematischen Lösungsmitteln oder über Chromatographie aufwendig entfernt werden. „Dabei entstehen viele Waschfraktionen mit schwer recycelbaren Stoffen – das macht den Prozess so teuer.“ Am Ende werden die Nebenprodukte meist verbrannt.
Umweltfreundlicher und energiesparender
Weil die Biotechnologie immer öfter Alternativen zu chemischen Katalysen bietet, hat Mehlmer sich gefragt, ob das nicht auch hier der Fall sein könnte, denn Enzyme sind in der Lage, eine Vielzahl komplexer Moleküle herzustellen. „Enzyme arbeiten sehr spezifisch, mit wenig Nebenprodukten und bei niedrigen Temperaturen, wodurch die Prozesse weniger Energie benötigen“, nennt der Projektleiter einige Vorzüge. Die Basis ist zudem Wasser statt ökologisch bedenklicher Lösungsmittel.
In der Literatur fand das Team tatsächlich „einige wenige“ Organismen, für die dokumentiert ist, dass sie in ihren Zellen Menthadienol bilden, darunter das afrikanische Zitronengras und die Bartblume. Letztere bekamen die Forscherinnen und Forscher in einer Gärtnerei sogar geschenkt, 14 Stück an der Zahl. „Zunächst haben wir untersucht, in welcher Menge die Pflanzen Menthadienol produzieren“, erzählt Mehlmer. Sechs Pflanzen erwiesen sich als besonders produktiv, einzelne bildeten die gesuchte Verbindung gar nicht.
Analysen von Genom, Transkriptom und Proteom
Aus diesen Pflanzen wählte das Team Exemplare aus, die sich zwar äußerlich ähnelten, aber in der produzierten Menge Menthadienol stark unterschieden. Dann sequenzierten sie deren Genome und annotierten die Gene – ordneten ihnen also aufgrund von Ähnlichkeiten mit bekannten Genen in Datenbanken mutmaßliche Funktionen zu. Ähnlich verfuhr das Team mit dem Transkriptom und dem Proteom, der Gesamtheit der mRNA und der daraus gebildeten Produkte. „Die Idee war, dass die eine Pflanze Menthadienol produziert, die andere nicht. Die eine muss also den gesuchten Biokatalysator bilden, die andere nicht“, erläutert Mehlmer. Die Untersuchungsergebnisse müssten sich an dieser Stelle somit unterscheiden.

Analog verfuhr das Team mit der Olivetolsäure, einem Molekül, das ebenfalls benötigt wird, um Delta-9-THC herzustellen. „Hier gibt es schon eine gut charakterisierte Biosynthese“, berichtet der Projektleiter. Doch dieser Herstellungsweg in rekombinanten Hefezellen ist patentiert und somit teuer. Literaturstudien ergaben den Hinweis, dass bestimmte Flechten Olivetolsäure in großer Menge bilden. „Eine Flechte ist aber eine symbiotische Lebensgemeinschaft aus Alge und Pilz“, sagt Mehlmer. „Wir mussten also herausfinden, welcher der beiden Organismen die Säure produziert“, erinnert sich der Genetiker und Pflanzenphysiologe. Doch DNA aus Flechten zu extrahieren, ist kompliziert. Gemeinsam mit einer Flechtenexpertin gelang es schließlich, den Pilz als Urheber zu identifizieren.
Enzyme in einen Produktionsorganismus transferieren
Anschließend bestand die nächste – gemeisterte – Herausforderung darin, die beiden Enzyme in einen Produktionsorganismus zu übertragen, der in der Biotechnologie gut etabliert ist, in diesem Fall die Hefe Saccharomyces cerevisiae. Alternativ wäre auch denkbar, die Enzyme nicht nur als einzelne Bausteine hinzuzufügen, sondern die Delta-9-THC-Biosynthese komplett in einem Organismus zu entwickeln – ein herausfordernder Ansatz, den das Team noch prüft.
Von März 2020 bis Juni 2023 lief das Projekt BigPharm, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit rund 718.000 Euro gefördert wurde. Die entsprechende Fördermaßnahme trägt den Titel „Maßgeschneiderte biobasierte Inhaltsstoffe für eine wettbewerbsfähige Bioökonomie“. Gemeinsam mit Projektpartnerin Tanja Gaich von der Universität Konstanz zeigt sich Mehlmer mit den Ergebnissen zufrieden: Bartblume und Flechten konnten erstmals sequenziert werden, was auch zu wissenschaftlichen Fachpublikationen führte. Außerdem hat das angewandte Forschungsprojekt deren relevante Enzyme identifiziert und in einen biotechnologischen Prozess integriert. Jetzt könnten Enzyme und Prozess weiter optimiert werden, um sie der Anwendung näherzubringen.
Beeindruckt hat Mehlmer zudem die hohe Qualität der Sequenzierergebnisse, die auf den PacBio Sequel IIe Sequencer des Lehrstuhls zurückgehen, sowie die Arbeit mit der Software zur Genomvorhersage. „In meiner Promotion habe ich drei, vier Jahre an 13 Genen verbracht, heute können wir ein viel größeres Genom in drei Wochen aufklären.“
Suche nach weiteren natürlichen Enzymen
Weiter geht es für den Forscher mit der Frage, welche weiteren cannabinoiden Substanzen in Pflanzen anzutreffen sind. Ähnlich zur Bartblume möchte die Gruppe bestimmte Rhododendronarten untersuchen und dort neue Enzyme identifizieren. Außerdem will der Genetiker die Enzyme aus Bartblume und Flechte verändern: In der Natur sind sie an ihre originären Organismen und Funktionen angepasst, in diesem Fall optimiert für die Nähe zu Membranen. Für eine effektive Produktion in rekombinanten Organismen müsste diese Eigenschaft verändert werden. Und ganz vielleicht gelingt es, den Organismus und seine Enzyme so zu programmieren, dass er Limonen futtert und fertiges Delta-9-THC produziert. „Dann müssten wir die Enzyme nicht aufreinigen“, hofft Mehlmer, denn das würde den Prozess noch günstiger gestalten.
Autor: Björn Lohmann