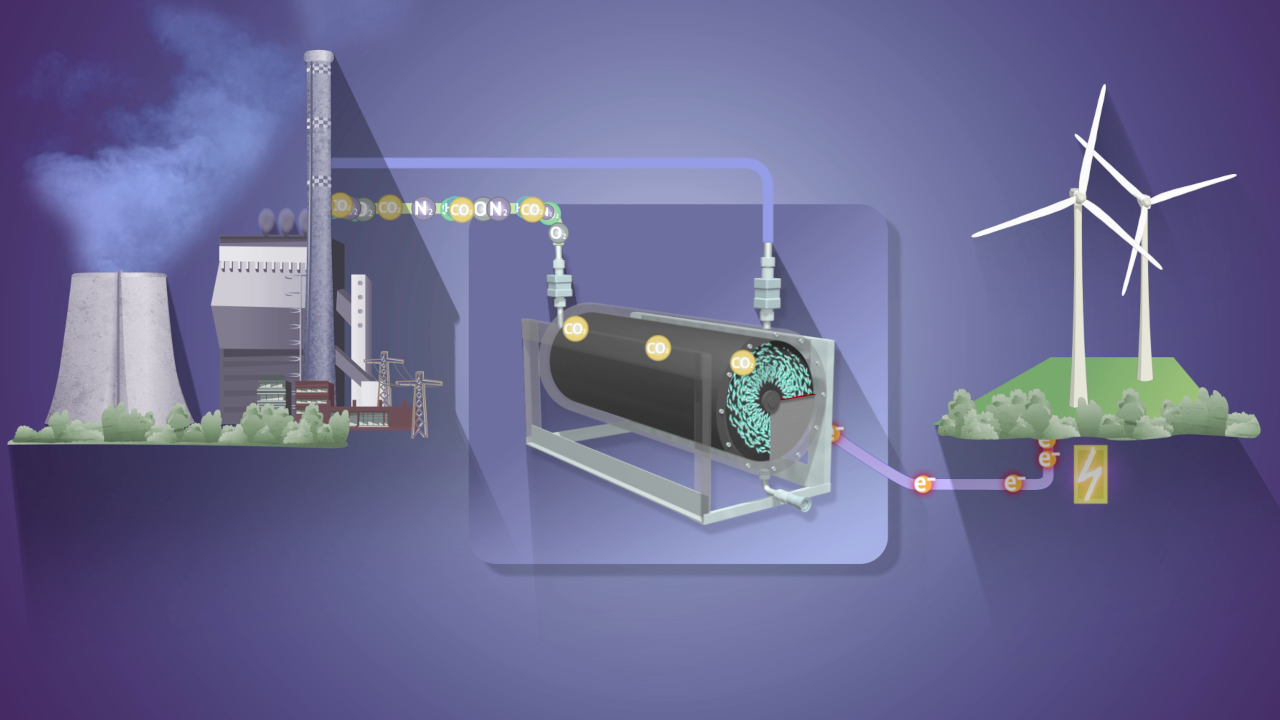Wie ein Meeresbakterium Öl verdaut
Forschende konnten klären, wie das ölfressende Meeresbakterium Alcanivorax borkumensis ein natürliches Spülmittel synthetisiert, um die im Erdöl enthaltenen Alkane vertilgen zu können.

Immer wieder kommt es auf den Weltmeeren zu Ölhavarien mit gravierenden Folgen für das ganze Ökosystem. Doch auch hier hat die Natur mikrobielle Helfer parat, die eine Ausbreitung des Ölteppichs und damit die Umweltverschmutzung eindämmen können. Dabei handelt es sich um Meeresbakterien, die sich von Erdöl ernähren. Ein Forschungsteam unter Leitung der Universität Bonn hat solch ein Meeresbakterium nun genauer unter die Lupe genommen. Daran beteiligt waren die RWTH Aachen, die HHU Düsseldorf sowie das Forschungszentrum Jülich.
Schon der lateinische Name des Bakteriums Alcanivorax borkumensis deutet an, wozu es fähig ist – nämlich Alkane zu fressen. Dabei handelt es sich um Kohlenwasserstoff-Ketten, die natürlicherweise im Meer vorkommen, aber eben auch in großen Mengen im Erdöl enthalten sind. Diese ölfressenden Mikroorganismen vermehren sich nach Tankerunfällen rasant. Dabei produzieren sie ein Biotensid. Das Molekül klammert sich an die Öltröpfchen und leistet so einen Beitrag zur Bekämpfung der Ölkatastrophe.
Meeresbakterium produziert natürliches Spülmittel
Da sich Wasser und Öl bekanntermaßen nicht mischen lassen, ist das Meeresbakterium auf chemische Hilfe angewiesen, um die begehrten Alkane zu verspeisen. Dafür produziert es den Forschenden zufolge ein natürliches Spülmittel – ein sogenanntes Detergens – das aus der Aminosäure Glycin und einer Zucker-Fettsäure-Verbindung besteht. „Die Moleküle bestehen aus einem wasserlöslichen und einem fettlöslichen Anteil. Die Bakterien setzen sich damit auf der Grenzfläche der Öltröpfchen fest und bilden dort einen Biofilm“, erklärt Biochemiker Peter Dörmann von der Universität Bonn.
Enzym-Trio wirkt als Biokatalysator
Wie das Team in der Fachzeitschrift Nature Chemical Biology berichtet, konnten Aachener Forschende im Genom von A. borkumensis ein Gencluster identifizieren, das an der Herstellung dieses Moleküls beteiligt ist. Waren die Gene dieses Clusters ausgeschaltet, konnten sich die Bakterien nicht mehr so gut an die Öltröpfchen anlagern. Sie nahmen weniger Öl auf und wuchsen deutlich langsamen. Jiaxin Cui, Doktorandin an der Uni Bonn, konnte schließlich den Syntheseweg klären, über den A. borkumensis das Detergens herstellt. Sie fand heraus, dass drei Enzyme an der schrittweisen Biokatalyse des Moleküls beteiligt sind.
Entwicklung neuer ölfressender Bakterienstämme
Die Erkenntnisse der Forschenden könnten dazu beitragen, neue Bakterienstämme zu entwickeln, die noch effektiver Ölverschmutzungen bekämpfen können. „Das natürliche Detergens könnte zudem auch für biotechnologische Anwendungen von Interesse sein – etwa für die mikrobielle Herstellung wichtiger chemischer Verbindungen aus Kohlenwasserstoffen“, sagt Dörmann.
bb