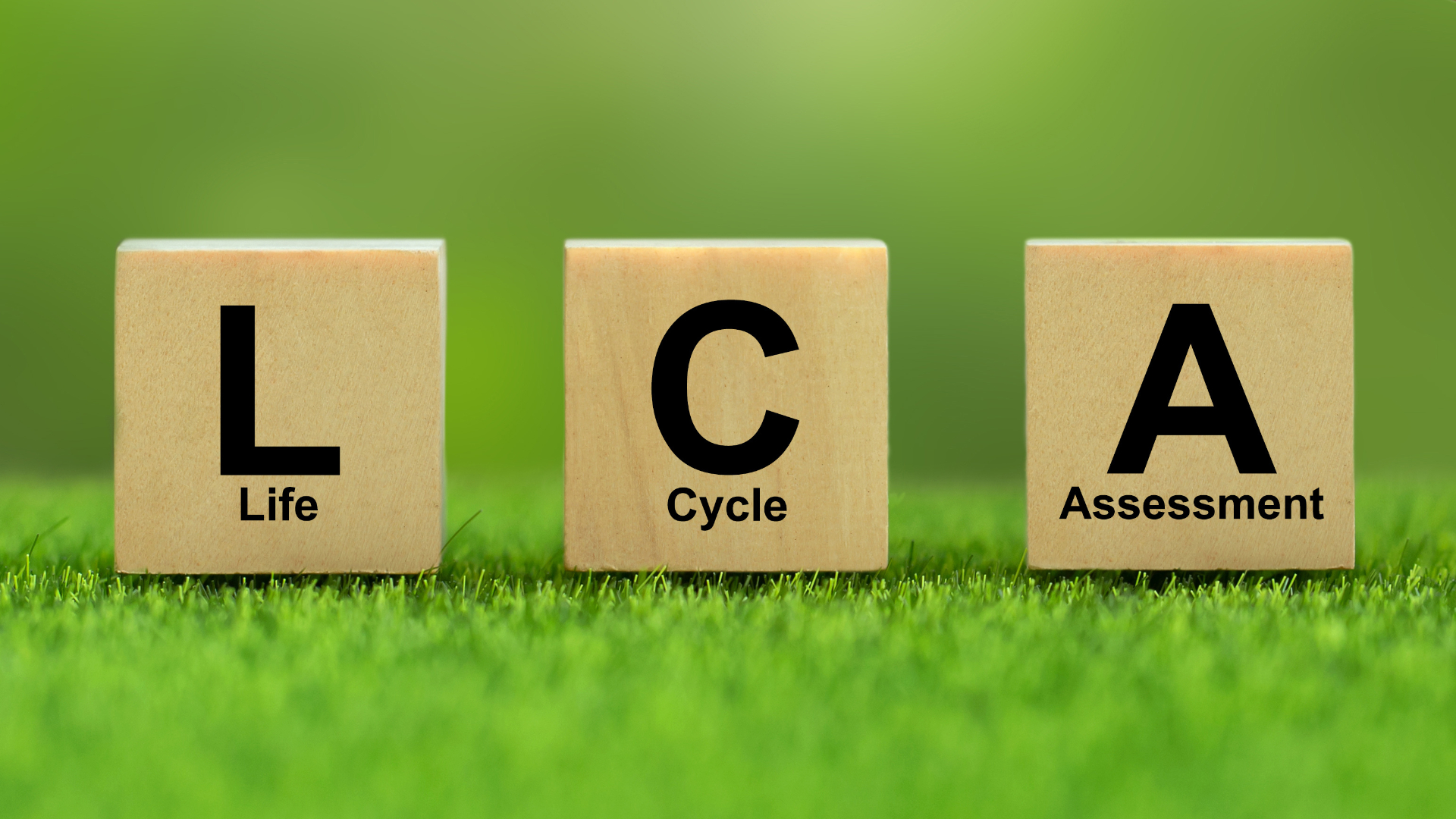Energien der Zukunft und Bioökonomie zusammengedacht
Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu sein. Um das zu erreichen, ist unter anderem eine umfassende Transformation der Energieversorgung nötig. Deshalb durchlaufen unsere Energiesysteme derzeit einen grundlegenden Wandel. Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien entwickeln sich kontinuierlich weiter. Nicht zuletzt, um fossile Ressourcen zu schonen, entstehen parallel auch neue Ansätze zur Verwendung biologischer Ressourcen und Prozesse in der Wirtschaft. Diese beiden Entwicklungen – Zukunftsenergien und Bioökonomie – weisen zahlreiche Berührungspunkte auf und können sich in ihrer Umsetzung gegenseitig verstärken.
Zukunftsenergien bezeichnen innovative Technologien und Konzepte, die über die effiziente Nutzung von Sonne, Wind und Wasser hinausgehen. Sie umfassen fortschrittliche Speichersysteme, neue Verfahren zur Energieumwandlung und intelligente Netztechnologien. Bioökonomie beschreibt die systematische Nutzung biologischer Ressourcen und Prozesse zur Herstellung von Produkten, Materialien und Energie.
Die Schnittstellen zwischen beiden Bereichen sind vielfältig: Biologische Materialien können als Grundlage für Energiespeicher dienen, während Energietechnologien bioökonomische Prozesse unterstützen. Darüber hinaus ermöglichen beide Ansätze die Entwicklung zirkulärer Wirtschaftsmodelle, in denen Abfälle zu Ressourcen und Stoffkreisläufe geschlossen werden.
Die folgenden Kapitel veranschaulichen, wie diese Verzahnung in der Praxis funktioniert und welche innovativen Lösungen daraus entstehen können.
Ideen, Projekte und Lösungen
Unter dem Motto „Entdecke die Energie von morgen“ hat das Wissenschaftsjahr sieben Themenbereiche identifiziert. Vier davon sind auf verschiedene Weise mit Bioökonomie verknüpft: Forschung zu Erneuerbaren Energien, Wasserstoff, Batterien sowie Photovoltaik. Zu jedem dieser vier Bereiche wird intensiv geforscht und folgend eine Auswahl an Ideen, Projekten und Lösungen vorgestellt.
Seite 2 von 5
Forschung zu Erneuerbaren Energien aus Biomasse
Bis 2030 sollen in Deutschland 80 % des Bruttostroms aus erneuerbaren Energien produziert werden, um bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Erneuerbare Energien sind Energiequellen, die entweder unbegrenzt verfügbar sind oder sich in kurzer Zeit natürlich erneuern – dazu zählen auch biobasierte Rohstoffe wie Algen, Holz, Stroh und Gras. Insbesondere Rest- und Abfallstoffe werden in der Bioökonomie vermehrt energetisch verwertet und stellen somit alternative und regenerative Energiequellen dar. Eine bedeutende Rolle spielt dabei schon länger die Biogastechnologie: In speziellen Anlagen werden Materialien wie Gülle, Pflanzenreste oder Bioabfälle unter Luftabschluss vergoren, wobei Biogas entsteht, das zur Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden kann. Aber auch andere, teils überraschende Reststoffe können dank innovativer Verfahren zur Energieversorgung beitragen.

BEFuel: E-Treibstoffe und Biotenside aus Abgasen und Abwasser
Seit Januar 2024 arbeitet ein interdisziplinäres Team unter Leitung von Fraunhofer UMSICHT im vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderten Projekt „BEFuel – Gekoppelte bioelektrochemische Produktion von E-Treibstoffen und hochwertigen Chemikalien aus Abgasen und Abwässern“ an einem neuartigen Verfahren für E-Fuels und Biotenside. Dabei werden zwei Abfallströme – Rohglyzerin aus der Biodieselproduktion und Abwasser aus Kläranlagen – mithilfe erneuerbarer Energie elektrochemisch verwertet. So entstehen Nährstoffe und grüner Wasserstoff, die von Mikroorganismen genutzt werden, um Biotenside sowie organische Säuren herzustellen. Diese können als Grundlage für Biodiesel und Biogas dienen.
Bioethanol aus Holzresten und landwirtschaftlichen Reststoffen
Forschende der TU München und der finnischen TU Lappeenranta haben ein Verfahren entwickelt, das aus Reststoffen wie Stroh oder Holz und Wasserstoff über Synthesegas, Methanol und Essigsäure preiswertes Ethanol erzeugt. Der Prozess erzielt mit bis zu 1.410 Litern Ethanol pro Tonne Trockenbiomasse deutlich höhere Erträge als die klassische Fermentation, weil er durch Wasserstoff-Ergänzung aus Elektrolyse eine Energieausbeute von 50-60 % erreicht, während die Fermentation nur 25-30 % der Biomasse-Energie in Ethanol umwandelt. Deshalb könnte er bei günstigen Strom- und Biomassepreisen ab etwa 0,65 Euro je Liter wettbewerbsfähig sein. Noch ist der Prozess nicht marktreif und die nationale Skalierung begrenzt – etwa wegen des unzureichenden Restholzpotenzials in Deutschland.
Bioethanol aus der Bäckerei
Die Universität Hohenheim hat gemeinsam mit der Bäckerei Webers Backstube in Friedrichshafen die erste deutsche Brotbrennerei eröffnet, die Bioethanol aus Altbackwaren produziert. Seit Februar 2024 werden in einer Pilotanlage wöchentliche Mengen von über zwei Tonnen nicht mehr verkäuflicher Backwaren vergoren und destilliert, um daraus Bioethanol für industrielle Anwendungen wie Desinfektionsmittel oder Kraftstoffe zu gewinnen.

Shit2Power: Kläranlagen als energieautarke Kraftwerke
Das Berliner Unternehmen Shit2Power nutzt Klärschlamm als Ressource zur Erzeugung erneuerbarer Energie. Mit einer innovativen Containeranlage wird der Klärschlamm vor Ort getrocknet, thermochemisch in ein energiereiches Gas umgewandelt und über Kraft-Wärme-Kopplung in Strom und Wärme umgesetzt. Dabei entsteht als Nebenprodukt phosphorreiche Asche, die für die Rückgewinnung von Phosphor genutzt werden kann – etwa als Rohstoff für Dünger.
Seite 3 von 5
Forschung zu Wasserstoff
Die Bundesregierung sieht Wasserstoff als Schlüsselelement für die Energiewende und die Erreichung der Klimaziele. Im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie werden Erforschung und Entwicklung von Wasserstofftechnologien gefördert. Die Bioökonomie trägt dazu bei, indem biogene Roh- und Reststoffe verwertet oder biotechnologische Prozesse zum Einsatz kommen. Umgekehrt können bioökonomische Produktionsprozesse Wärme oder Gase, die bei der Wasserstofferzeugung entstehen, als klimaneutrale Ressourcen nutzen.

H2Wood: Biowasserstoff aus Holzabfällen
Im Projekt H₂Wood – BlackForest entwickeln Forschende der Fraunhofer-Institute für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB und für Produktionstechnik und Automatisierung IPA gemeinsam mit regionalen Partnern seit August 2021 eine biotechnologische Methode, um aus Holzabfällen grünen Wasserstoff zu gewinnen. Dabei werden die Holzabfälle mithilfe von Ethanol aufgeschlossen, enzymatisch zu Zucker abgebaut und anschließend durch Bakterien fermentiert, wobei rund 50 Liter Wasserstoff pro Kilogramm Holz entstehen. Das ebenfalls entstehende CO₂ wird von Mikroalgen in einem angeschlossenen Photobioreaktor verwertet. Eine Pilotanlage am Campus Schwarzwald soll noch 2025 in Betrieb gehen und das Verfahren im industriellen Maßstab demonstrieren.
SmartBioH2-BW: Mit Bakterien und Mikroalgen zu Biowasserstoff
Ziel des Projekts SmartBioH2-BW war es, am Standort der Evonik Operations GmbH in Rheinfelden eine Bioraffinerie aufzubauen, die aus industriellen Abwasser- und Reststoffströmen Biowasserstoff und biobasierte Wertstoffe gewinnt. Dafür haben Forschende gemeinsam mit Evonik drei Jahre lang zwei biotechnologische Verfahren mit Purpurbakterien und Mikroalgen entwickelt. Viele der Nebenstoffströme aus der chemischen Produktion wurden bislang verbrannt oder in Kläranlagen behandelt. Im August 2024 wurde die Raffinerie in Betrieb genommen.
SektoRAS: Aquakultur und Energie
Das Projekt SektoRAS (Entwicklung von Sektorenkopplungskonzepten für Regenerative Energien und Aquakultursysteme) untersucht, wie sich Aquakultur mit wasserstoffbasierter Energiewirtschaft verknüpfen lässt, um Synergien bei Energie- und Stoffströmen zu nutzen. Bis 2027 soll eine Energiewandlungsanlage (Power-to-Gas) gebaut werden, die in Lübesse südlich von Schwerin grünen Wasserstoff und anschließend Methan/LNG produziert sowie Wärme, Sauerstoff und grünen Strom liefert. Eine geplante Aquafarm (Leuchtturmprojekt Aquafarm Lübesse) soll diese Produkte – speziell Abwärme und Sauerstoff – nutzen, um in einer geschlossenen Kreislaufanlage Süßwasserfische klimaneutral und ressourceneffizient zu züchten.

Wasserstoff aus Sonnenenergie und Cyanobakterien
Forschende um Kirstin Gutekunst haben eine Methode entwickelt, bei der bestimmte Cyanobakterien Sonnenenergie direkt in Wasserstoff umwandeln, ohne dabei CO₂ zu erzeugen, indem sie ein Enzym (Hydrogenase) mit dem sogenannten Photosystem I verbinden. Dieser lebende Zellprozess ermöglicht eine dauerhafte und effiziente Wasserstoffproduktion, da die Zellen die Fusion aus Hydrogenase und Photosystem selbst reparieren und bei der Teilung an neue Zellen weitergeben. Zurzeit wird noch daran geforscht, wie verhindert werden kann, dass Sauerstoff die beteiligten Enzyme hemmt.
Seite 4 von 5
Forschung zu Batterien
Batterien sind entscheidend für die zukünftige Energieversorgung, weil sie erneuerbare Energiequellen wie Sonne und Wind speicherbar und jederzeit nutzbar machen. Sie ermöglichen so eine stabile und flexible Stromversorgung trotz schwankender Erzeugung. Innovative biobasierte Materialien und Kreislaufprozesse können dabei helfen, Batterien umweltfreundlicher und ressourcenschonender herzustellen.

CMBlu Energy: Organische Batterien aus Lignin
Die CMBlu Energy AG entwickelt sogenannte Organic-SolidFlow-Batterien, in denen elektrische Energie in flüssigen, organischen Elektrolyten gespeichert wird. Der Grundbaustein für die Elektrolyte ist Lignin, ein natürlicher Bestandteil von Holz und ein Nebenprodukt der Papierindustrie. Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien verwendet CMBlu recycelbare, nicht brennbare Materialien, die keine seltenen oder konfliktbeladenen Rohstoffe benötigen. Die modulare Bauweise ermöglicht eine flexible Skalierung der Leistung und Kapazität. Dadurch ist die Speichertechnologie für großflächige Anwendungen wie erneuerbare Energieintegration, industrielle Nutzung und Elektromobilität geeignet.
Bio-Batterie aus Pilzen
Forschende des Schweizer Empa-Labors Cellulose & Wood Materials haben eine 3D-gedruckte und biologisch abbaubare mikrobielle Brennstoffzelle entwickelt, die mit Pilzhyphen betrieben wird und Strom für einige Tage liefern kann – etwa für Temperatursensoren auf dem Feld. Kombiniert werden zwei Pilzarten: ein Hefepilz (Anode) liefert Elektronen durch Nährstoffabbau, ein Weißfäulepilz (Kathode) produziert ein Enzym, das Elektronen zur Stromabgabe ableitet. Die Batterie kann getrocknet transportiert und vor Ort mit Wasser und Zucker reaktiviert werden. Nach dem Einsatz baut sie sich selbst ab.

HANa: Batterien aus Holzabfällen
Das HANa-Projekt (Hoch performante Anodenmaterialien für ressourcenschonende Na-Ionen-Batterien auf Basis von Lignin und Hemicellulose aus Laub- und Nadelholzabfällen) an der Hochschule Aalen erforscht seit 2024, wie sich aus Laub- oder Nadelholzabfällen hochwertige Anodenmaterialien für Natrium-Ionen-Batterien herstellen lassen. Dafür werden die Stoffe Lignin und Hemicellulose (zwei Bestandteile des Holzes) mit einem speziellen Verfahren herausgelöst und in hartem Kohlenstoff umgewandelt. Ziel ist es, eine ressourcenschonende Batterietechnologie zu entwickeln, die eine umweltfreundlichere Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien darstellt.
Mikrobielle Elektrobiotechnologie
Falk Harnisch und seine Arbeitsgruppe Elektrobiotechnologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung arbeiten daran, biologische Abfallstoffe zu nutzen und gleichzeitig Chemikalien herzustellen sowie Energie zu gewinnen. Beispielsweise haben sie ein bioelektrochemisches Verfahren entwickelt, das bestimmte Bakterien wie Geobacter sulfurreducens oder Shewanella oneidensis nutzt, um Abwasser zu reinigen. Dabei wird nicht nur Strom erzeugt, sondern auch die Menge an Klärschlamm und der Verbrauch für die energieintensive Belüftung deutlich verringert. Zusätzlich können mikrobielle Gemeinschaften gesundheits- und umweltschädliche Stoffe wie Nitrate, Nitrite und Ammoniumverbindungen im Trinkwasser abbauen und in unbedenkliche Stickstoffverbindungen umwandeln.
Mit Mikroorganismen Energie speichern: Entwicklung einer mikrobiellen Power-to-Gas-Elektrolysezelle
Im KMU-innovativ-Projekt PtGMEC der Electrochaea GmbH wurde eine mikrobiell-elektrolytische Zelle entwickelt, in der einzellige Mikroorganismen (Archaeen) überschüssigen Strom in klimaneutrales Methan umwandeln können. Die Verwendung eines biologischen Biokatalysators ermöglicht die Methanproduktion mit nahezu vollständiger Umwandlung von CO₂ und hoher Energiedichte in einem kompakten Reaktor. Damit wurde ein effizienter und kostengünstiger Ansatz für die großskalige Energiespeicherung mittels Power-to-Gas geschaffen.
Seite 5 von 5
Photovoltaik
Photovoltaik (PV) ist in Deutschland inzwischen weit verbreitet und stellt einen zentralen Baustein der nationalen Stromerzeugung dar. Im Jahr 2024 deckte die Sonnenenergie rund 12 % des Bruttostromverbrauchs und sie verzeichnet weiterhin einen kontinuierlichen Ausbau. Auch die Agri-Photovoltaik (Agri-PV, siehe Themendossier, bei der Nutzflächen für Nahrungsmittelproduktion und Stromerzeugung kombiniert werden, gewinnt zunehmend an Bedeutung und bietet vielfältige Einsatzgebiete: Solarpaneele über Biogetreidesorten wie zum Beispiel Urdinkel, über Erd- und Himbeeren, über Haselnüssen und Trüffel oder über Hopfen. Neben der Nutzung klassischer agrarforstlicher Flächen existieren weitere innovative Ansätze zur Integration von Photovoltaik, von denen einige im Folgenden vorgestellt werden.

MoorPower: Wiedervernässung und PV
Das Projekt MoorPower erforscht, wie sich gleichzeitig Moore wiedervernässen und bodengebundene Photovoltaikanlagen („Peatland PV“) errichten lassen – technisch, ökologisch, rechtlich und wirtschaftlich. Auf drei Versuchsflächen in Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg und Niedersachsen werden PV-Systemvarianten unter unterschiedlichen Wasserstandsbedingungen untersucht. Ziel ist es, Empfehlungen für die praktische Umsetzung in Deutschland abzuleiten, um Klimaschutz durch Wiedervernässung, fossilfreie Energiegewinnung und Potenzial für Paludikultur (siehe Themendossier) zu vereinen und damit auch die Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit in der Landwirtschaft zu verbessern. Das Projekt läuft bis Juni 2028 und wird vom BMFTR gefördert.

Erste Moor-PV-Anlage
Im September 2024 begann der Bau der ersten Moor-PV-Anlage in Deutschland. Das Solarenergie-Unternehmen WI Energy hat in Kooperation mit lokalen Landwirtinnen und Landwirten die Wiedervernässung einer Moorfläche initiiert – eine Kombination aus Renaturierung und Energiegewinnung. Somit ergibt sich eine Doppelnutzung: Zum einen bleibt eine extensive Nutzung, etwa zur Schafbeweidung, weiterhin möglich und zum anderen können die Flächen für Photovoltaik genutzt werden. „Mit diesem Projekt zeigen wir, dass Moore nicht nur wertvolle Ökosysteme, sondern auch gute Standorte für nachhaltige Energiegewinnung sind“, so Ingo Berens, Geschäftsführer der WI Energy. „Die Moor-PV-Anlage in Varel ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer klimaneutralen Zukunft.“
SHRIMPS: Aquakultur und PV
Im Projekt SHRIMPS (SolarAquaculture Habitats as ResourceEfficient and Integrated Multilayer Production Systems) hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE gemeinsam mit Partnern im Mekong-Delta untersucht, wie sich Aquakultur (Shrimps und Pangasius) und Photovoltaik auf derselben Fläche kombinieren lassen. In geschlossenen Systemen über den Teichen ermöglichen Solarmodule nicht nur Stromerzeugung, sondern reduzieren auch Verdunstung, schützen vor Krankheiten und Raubtieren, verbessern das Mikroklima und senken den Antibiotika-Einsatz. Erste Analysen zeigten, dass die 1-Megawatt-Pilotanlage etwa 15.000 Tonnen CO₂ pro Jahr einsparen und den Wasserverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Shrimps-Farmen um ca. 75 % senken kann.
Cow-PV: Kühe und PV
Das Unternehmen Nestlé lässt in Kooperation mit der BayWa AG und dem Landwirt Gerhard Metz eine Agri-PV-Anlage mit rund 7.800 Solarmodulen auf einem 4,74 ha großen Feld nahe dem Werk in Biessenhofen (Allgäu) errichten. Etwa ein Viertel des Werksstroms soll damit gedeckt werden. Die Module bieten Kühen Schatten und Unterstand und ermöglichen gleichzeitig eine Heuernte mit Maschinen – entsprechend der DIN SPEC 91492-Norm. Diese ergänzt seit Juni 2024 die bisherige DIN SPEC 91434 und spezifiziert die Anforderungen an die Tierhaltung im Kontext von Agri-Photovoltaik. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für die zweite Jahreshälfte 2025 geplant.