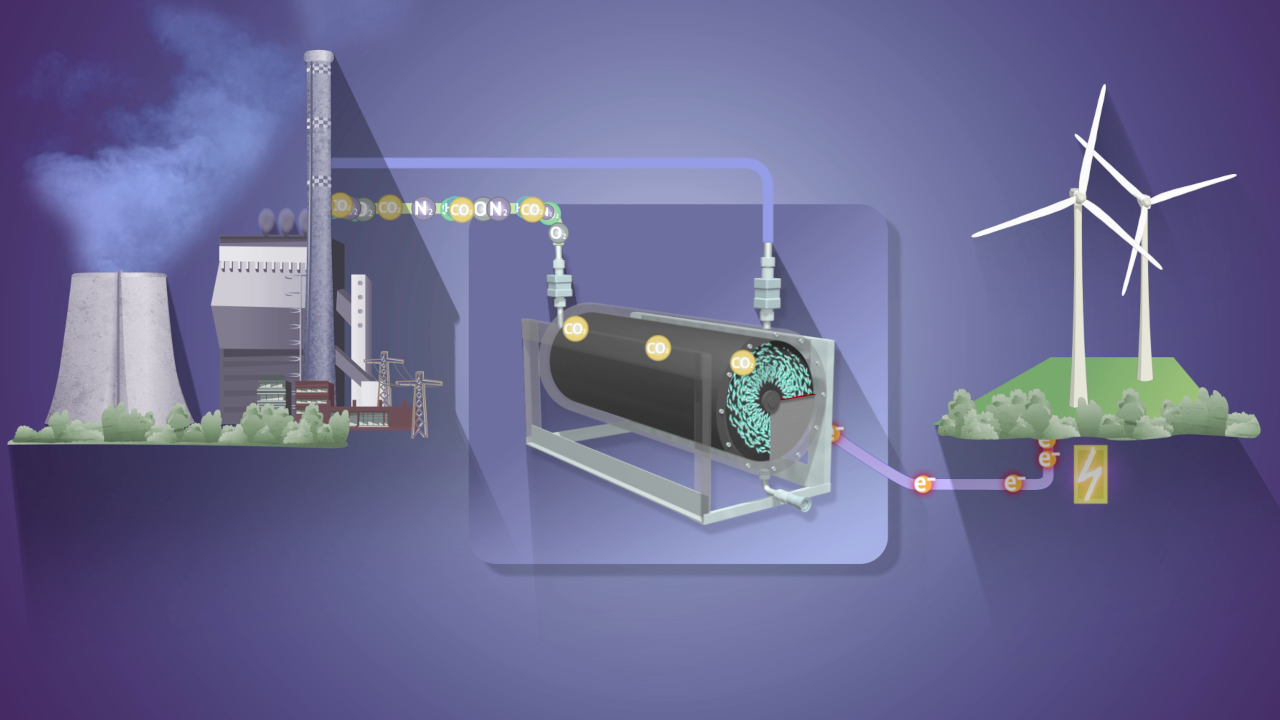Quietscheenten bestehen meist aus dem Kunststoff PVC und enthalten Weichmacher. Der Weichmachergehalt in einer typischen Badeente ist bemerkenswert hoch: Es sind 35% bis 40%. Und nicht nur Quietscheenten benötigen Weichmacher. Sie stecken nicht nur in dem Kinderspielzeug, sondern auch im Verpackungsmaterial, in Kunststoffbauteilen oder in Medizinprodukten. Wer nachhaltige, biobasierte Kunststoffe als Alternative zu petrochemischen Produkten wünscht, der benötigt daher auch biobasierte Lösungen für Weichmacher. Genau das haben sich Projektpartner von der TU Hamburg, der Universität Bielefeld und des Chemiekonzerns BASF auf die Fahnen geschrieben. „Bio-Weichmacher“ heißt das Projekt, das die Grundlagen für die weitere Entwicklung gelegt hat.
Tausende von Substanzen gescreent
„Das ist eine Hochrisikoaufgabe“, begründet BASF-Toxikologe Rainer Otter, weshalb es für das Projekt eine Förderung des Bundesforschungsministeriums in Höhe von 600.000 Euro brauchte. „Wir haben x-tausend Substanzen gescreent, die Anforderungen sind riesig.“ Das bestätigt Andreas Liese, Bioverfahrenstechniker an der TU Hamburg, den es gereizt hat, sich anstelle von nachhaltigen Prozessen für die Feinchemie an ein Massenprodukt zu wagen: „In der Feinchemie können Sie fast schon über die Pilotierung wirtschaftlich relevante Mengen herstellen. Hier sprechen wir aber über ein weltweites Marktvolumen von neun Millionen Tonnen jährlich.“ Das stelle ökonomisch ganz andere Anforderungen. Nicht zuletzt hat die chemische Industrie, die heute am Markt etablierten Weichmacher über Jahrzehnte qualitativ sehr weit optimiert.
Einen Haken haben einige der heutigen, meist Phthalat-basierten Weichmacher neben ihrer fossilen Herkunft jedoch: Oftmals gibt es gesundheitliche Bedenken, wenn sich die Weichmacher aus dem Produkt lösen können. „Wir haben uns daher gefragt: Wie würde ein idealer Weichmacher aussehen?“, erläutert Harald Gröger, organischer Chemiker und Biotechnologe an der Universität Bielefeld. Die Antwort lautete: Er muss aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden können, toxikologisch sicher sein, günstig herzustellen sein und mindestens die gleiche hohe Performance wie die am Markt etablierten Weichmacher aufweisen – beispielsweise hinsichtlich Reinheit, Viskosität, Kältebruchtemperatur und Lösetemperatur. „Bei keinem der Kriterien kann man Kompromisse machen“, betont Gröger die Besonderheit des Vorhabens. „Das ist entsprechend kein Halbjahresprojekt, sondern eine Perspektivaufgabe.“ Oder wie Otter es formuliert: „Im Auto darf nichts brechen, und der Plasmabeutel in der Blutbank sowieso nicht.“ Es bringe nichts, wenn das Produkt grün sei, aber in der Technik nicht mindestens vergleichbar mit heutigen Weichmachern.
Furan aus Kleie als Rohstoff
In einem aus Kleie als Abfallstoff zugänglichen Furan-Molekül fanden die Forschenden ein vielversprechendes Ausgangsmolekül. „Es war biobasiert, könnte sich ökonomisch herstellen lassen und es wird nahezu kein Lösungsmittel für die nur einfachen, etablierten chemischen Reaktionen ausgehend von dieser Verbindung benötigt“, erinnert sich Gröger. Allerdings war dann beispielsweise die Viskosität beim einleitenden Produktmuster deutlich zu hoch.
Das Forschungsteam hat daher unzählige chemische Modifikationen erprobt. Jedes Mal mussten zunächst entsprechende Reaktionen entwickelt und bis zu rund 100 Gramm der Substanz erzeugt werden, damit das BASF-Team die Performance-Eigenschaften bestimmen konnte. Immer wieder lautete das Fazit: Ganz gut, aber hier oder da noch nicht gut genug. Hätte eine der Verbindungen den Qualitätstest bestanden, wäre die nächste Herausforderung gewesen, die tausendfache Menge zu produzieren, denn die wäre für weitere anwendungstechnische und die toxikologischen Tests erforderlich.
Viel über die Weichmacherwirkung gelernt
Im Projekt ist es dazu jedoch nicht gekommen. Das ideale Molekül war noch nicht dabei – und die Projektpartner rechnen nicht damit, in weniger als zehn Jahren wirklich ein marktreifes Produkt präsentieren zu können. „Aber wir haben heute einen Grundbaustein und eine Substanzbibliothek“, resümiert Gröger. Zahlreiche Zusammenhänge zwischen chemischen Strukturen und deren Wirkung hat das Team aufgeklärt und auch wissenschaftlich publiziert. „Wir haben viel gelernt, welche chemischen Gruppen und Strukturen für die Weichmacherwirkung notwendig sind.“
Jetzt geht es darum, die Strukturen möglichst rational weiter zu variieren, ausgehend vom Grundmolekül 2-Methylfuran. Denn weitergehen wird das Unterfangen auf jeden Fall, auch wenn der Förderzeitraum nur von 2017 bis 2021 lief. Das bleibt jedoch Handarbeit im Labor, denn die Projektbeteiligten können bislang noch nicht Computersimulationen und die Möglichkeiten der KI in dem Maße nutzen, wie es beispielsweise in der Proteinchemie inzwischen Standard ist. Eine große Herausforderung besteht darin, dass bisher die Performance nicht mit der Struktur und toxikologischen Daten zu korrelieren ist. „Wir können bislang noch nicht am Computer ohne experimentelle Arbeiten im Labor einen qualitativ perfekten Weichmacher entwerfen“, erläutert Gröger. „Ergänzend müssen wir im Bulkbereich zudem bei der Wahl der Reaktionen und Reaktanden auf den Preis achten.“ In Frage kommen also nur Strukturen, die sich mit einfach zugänglichen Reaktionen, idealerweise ohne jeglichen Abfall, aus biobasierten Stoffen erzeugen lassen. Die Lösung gibt es, da sind sich alle drei Partner heute sicher. Doch die Suche wird noch eine ganze Weile andauern.
Autor: Björn Lohmann