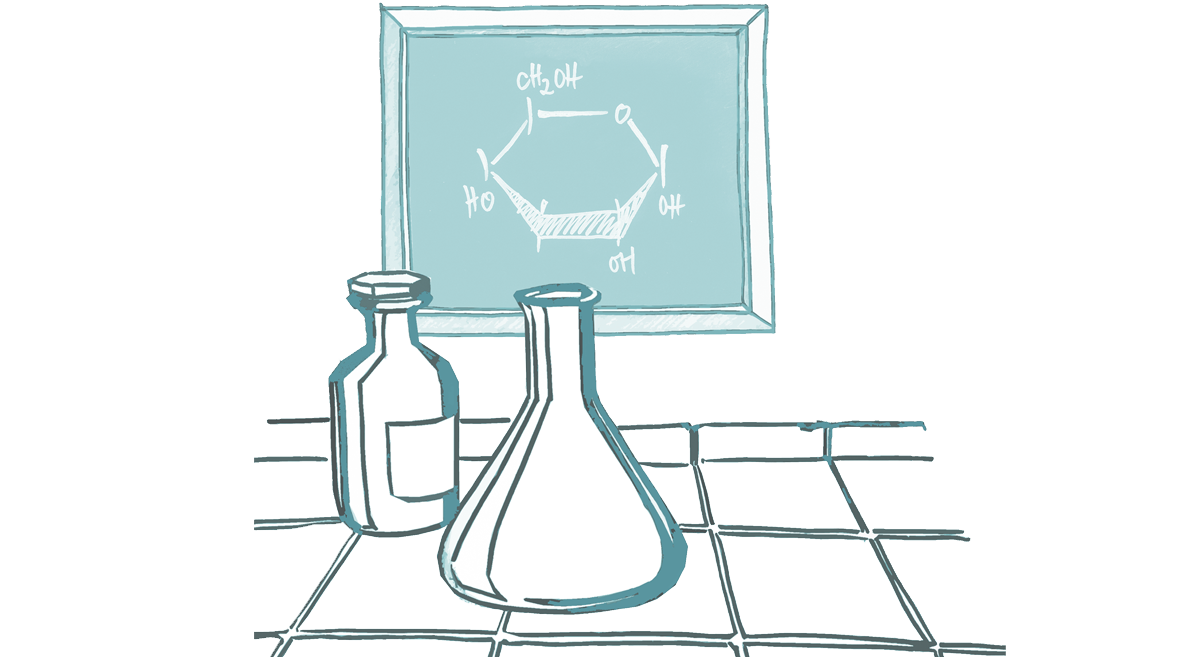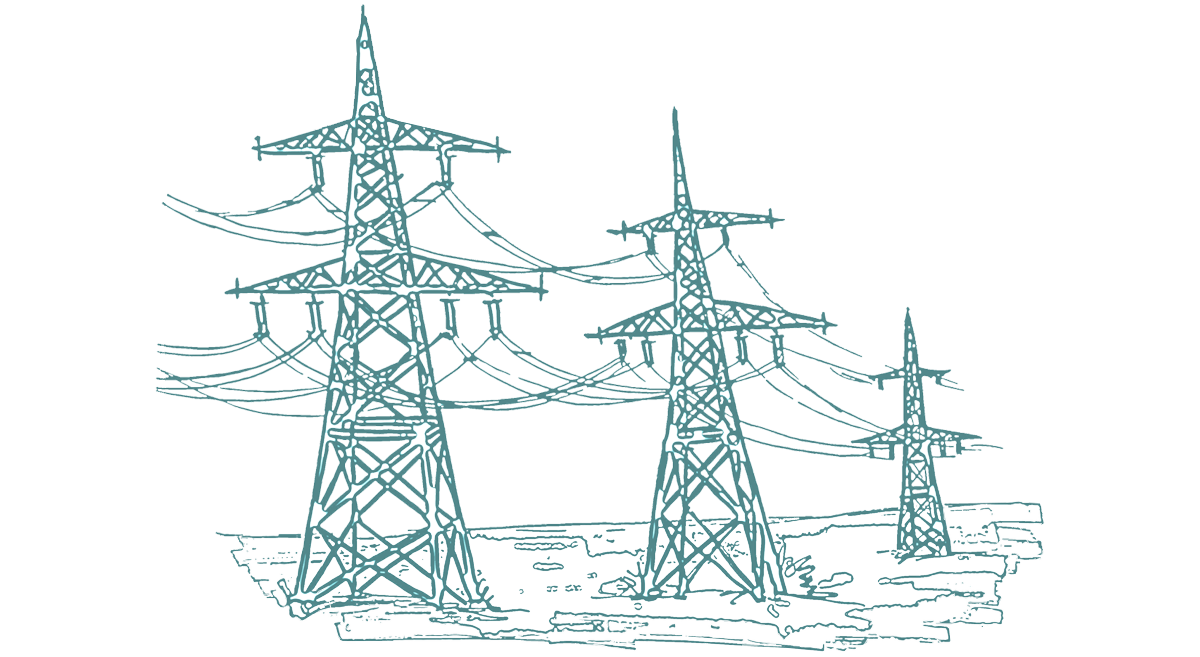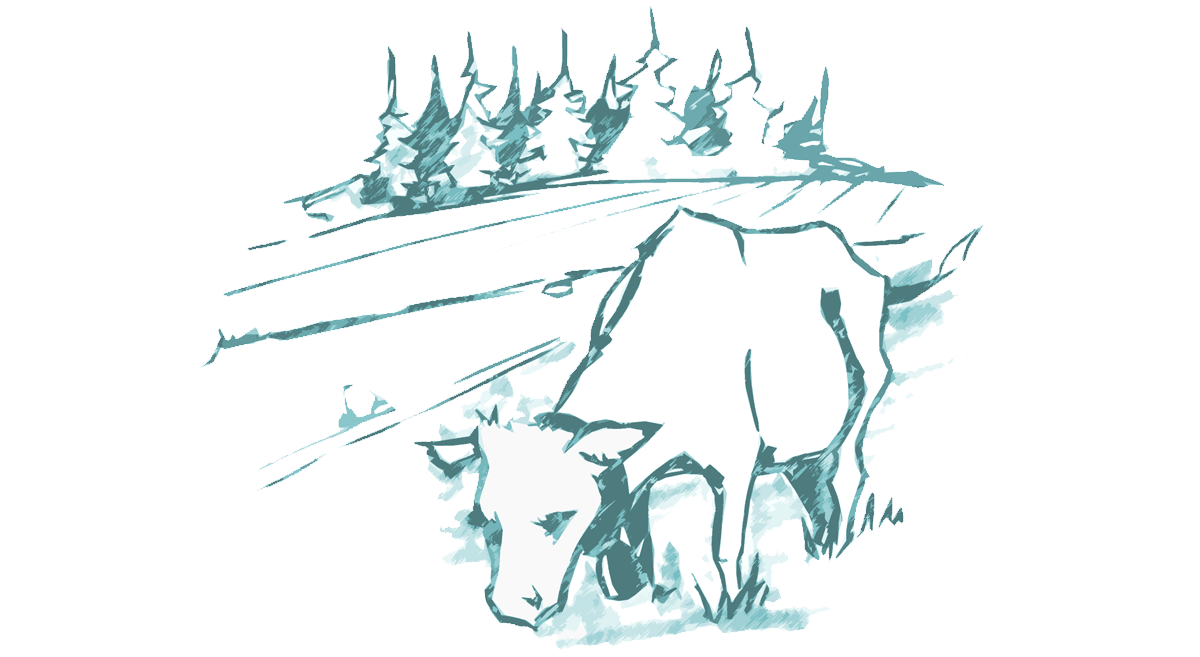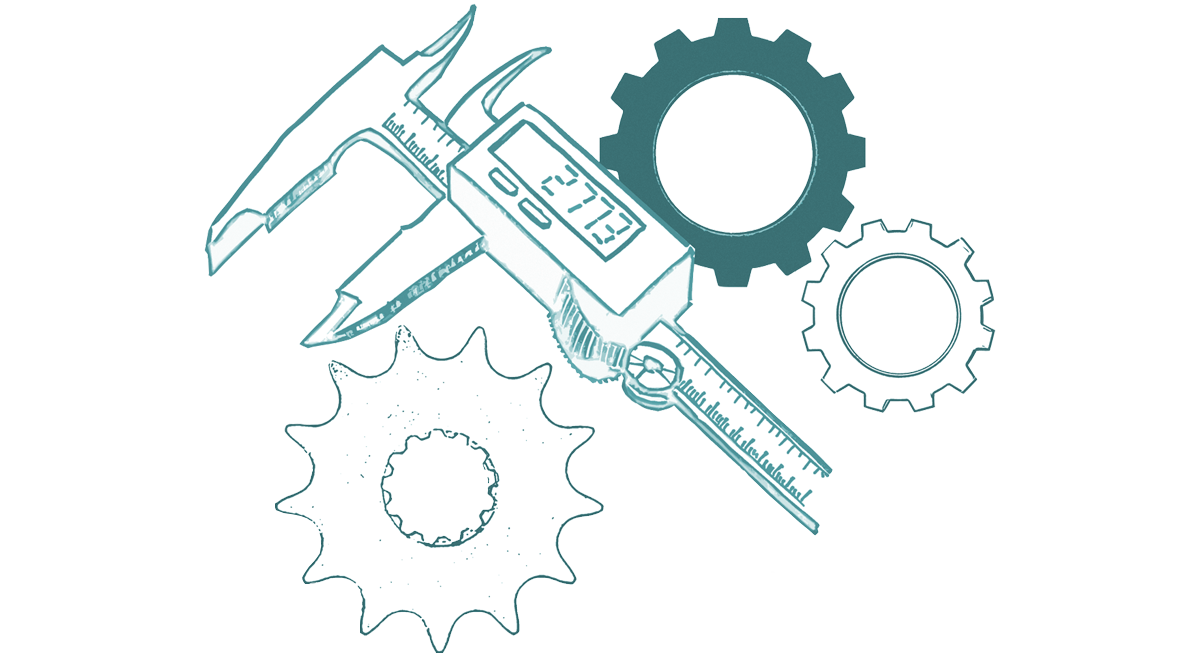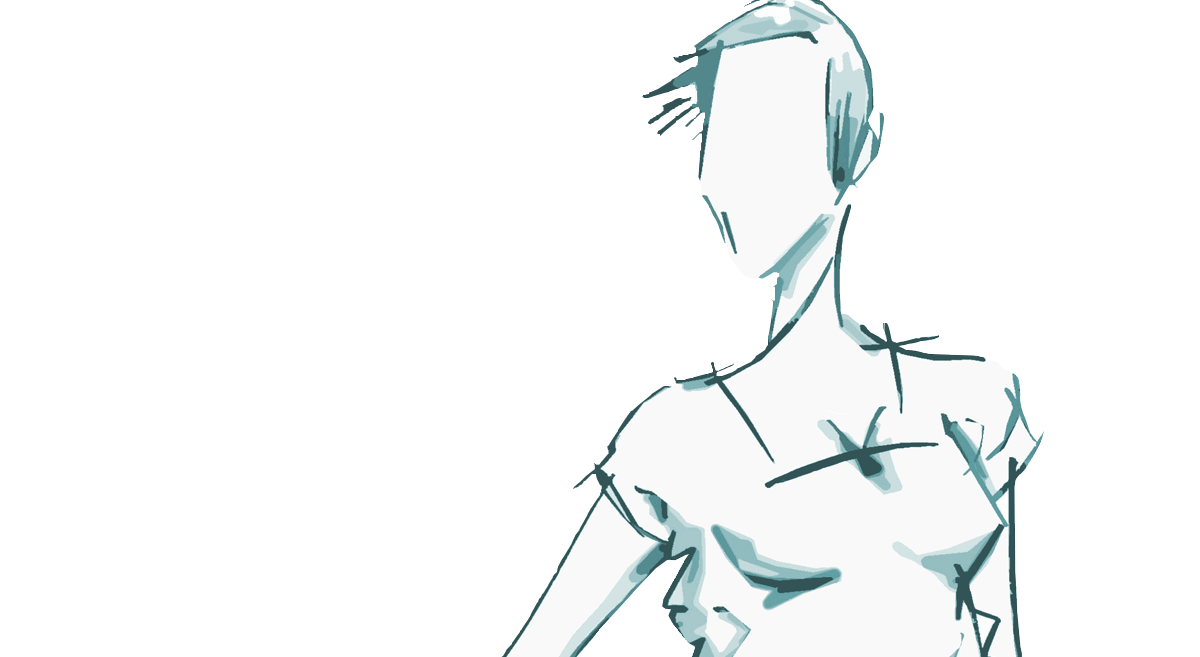Pharma
Schon seit Jahrtausenden helfen Heilkräuter, Krankheiten zu lindern. Immer häufiger kommen heute biotechnologische Verfahren bei der Produktion von Medikamenten zum Einsatz. Biopharmazeutika, zu denen Wirkstoffe wie Antikörper, Enzyme oder Impfstoffe zählen, machen rund ein Drittel des Pharmamarktes aus – mit stark steigender Tendenz.
Beispiele aus der Bioökonomie:
Biopharmazeutika
- Antikörper
- Impfstoffe
- Enzyme
Arzneipflanzen

Mit Blick auf die Herstellung von Arzneimitteln greifen Pharmaunternehmen zunehmend auf biologisches Wissen zurück. Zwar bilden chemisch synthetisierte Wirkstoffe nach wie vor den größten Anteil im deutschen Arzneimittelmarkt, die sogenannten Biopharmazeutika rücken jedoch zunehmend auf. Diese Medikamente sind Biomoleküle, die so groß sind, dass sie chemisch nicht oder nur sehr aufwändig herzustellen wären. Für ihre Herstellung bedient man sich der Methoden der modernen Biotechnologie: Lebende Mikroorganismen oder Zellen höherer Lebewesen lassen sich mithilfe molekulargenetischer Verfahren zu Mini-Fabriken für Medikamente umfunktionieren.
Laut Branchenreport der Boston Consulting Group und des vfa bio waren Ende 2020 in Deutschland insgesamt 339 Biopharmazeutika zugelassen. Der Marktanteil dieser biotechnologischen Arzneimittel am Gesamt-Pharmamarkt stieg damit hierzulande auf fast 31 %. Insgesamt wurden im Jahr 2020 14,6 Mrd. Euro mit Biopharmazeutika umgesetzt: etwa Antikörper gegen Krebs oder Autoimmunkrankheiten wie Rheuma oder Multiple Sklerose, Hormone wie Insulin zur Behandlung von Diabetes oder Enzyme gegen Stoffwechselkrankheiten.
Gentechnisch hergestellte Medikamente für Menschen und Tiere finden breite gesellschaftliche Akzeptanz. Allein 2020 wurden 25 weitere Biopharmazeutika neu zugelassen. Neben dem einstigen Standort von Hoechst in Frankfurt, der inzwischen zum französischen Unternehmen Sanofi gehört, hat sich auch der Schweizer Pharmakonzern Roche mit seinem Standort in Penzberg mit umfassenden Produktionskapazitäten für Biotech-Medikamente etabliert. Hinzukommen deutsche Unternehmen mit signifikanten Produktionsanlagen: Bayer in Leverkusen, Merck in Darmstadt sowie Boehringer Ingelheim in Biberach. Des Weiteren hat sich eine Reihe von kleineren und mittleren Biotechnologie-Unternehmen darauf spezialisiert, als Dienstleister die biobasierte Produktion zu übernehmen oder bei der Entwicklung und marktgerechten Umsetzung entsprechender Verfahren zu helfen. Im Jahr 2020 wurden deutschlandweit die Produktionskapazitäten für Biopharmazeutika auf ein Gesamtvolumen von 380.000 Litern taxiert. Deutschland liegt weltweit auf dem fünften Rang hinter den USA, Südkorea, Irland und der Schweiz. In Sachen biotechnologische Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen zählt Deutschland international zur Spitze.
Unter den Biopharmazeutika sind insbesondere die Antikörper in den Fokus gerückt. Diese komplexen Proteinmoleküle gelten als die Spür- und Lenkwaffen des menschlichen Immunsystems, weil jeder von ihnen sich nur an ein ganz bestimmtes Molekül heftet – das Oberflächenprotein eines Virus beispielsweise oder das Toxin eines Bakteriums. Durch die Bindung markieren die Antikörper ihr Zielmolekül für das Immunsystem und bereiten dessen Abbau vor. Antikörper werden mithilfe von Zellkulturen hergestellt. Ende 2020 waren 107 Antikörper-basierte Medikamente zugelassen, das sind 32 % aller zugelassenen Biopharmazeutika. Vor allem die Behandlung von Krebs oder Autoimmunkrankheiten hat sich mit Antikörpern signifikant verbessert. 10 Mrd. Euro setzte die Industrie in Deutschland mit Antikörpern um.
Peptide sind kleine Eiweißmoleküle, die aus bis zu 100 Aminosäuren zusammengesetzt sind. In der Pharmaindustrie und der Kosmetik sind sie als Wirkstoffe oder bioaktive Inhaltsstoffe für Cremes und Salben gefragt. Das Düsseldorfer Unternehmen Numaferm hat ein biotechnisches Verfahren entwickelt, um gewünschte Peptide in großer Menge mithilfe von Mikroorganismen herzustellen. Hierbei wurde das Start-up mehrfach vom BMBF unterstützt.
Auch andere Medikamentenklassen, etwa Antibiotika und Impfstoffe, werden heute in der Regel auf biotechnologischem Wege hergestellt. In Deutschland werden insbesondere Impfstoffe gegen Grippe, Frühsommer-Hirnhautentzündung (FSME), Diphtherie, Keuchhusten, Tollwut, Ebola und seit 2020 auch COVID-19 produziert.
Die Corona-Pandemie hat einen Boom der Impfstoff-Forschung und -Produktion bewirkt. In Marburg hat das Mainzer Unternehmen BioNTech eine innovative Anlage zur Produktion von mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 in Betrieb genommen. Die mRNA-Impfstoffe werden in einem zellfreien Produktionsverfahren gewonnen. Das heißt, hier wird nicht mit lebenden Zellen produziert. Stattdessen wird die Synthese der Biomoleküle mit allen dafür notwendigen Komponenten in einem Reaktionsgefäß durchgeführt.

Damit all diese Medikamente effizient und in den erforderlichen Mengen produziert werden können, ist eine intelligente Bioprozesstechnik gefragt (vgl. Maschinenbau). Mit seiner bioverfahrenstechnischen Expertise ist Deutschland hier weltweit federführend. Mit Unterstützung des BMBF wird daran gearbeitet, aktuelle Herausforderungen in diesem Feld auch künftig zu meistern. Dazu gehört unter anderem eine optimierte Prozessführung auf der Basis intelligenter Sensortechnik. Im Rahmen der strategischen Allianz „Wissensbasierte Prozessintelligenz“ haben rund 20 Partner eine Sensor- und Softwareplattform entwickelt, die neuartige Messprinzipien mit moderner Datenauswertung kombiniert. Aber auch die stete Verbesserung der Aufreinigung ist bei biotechnologisch hergestellten Medikamenten eine zentrale Frage, weshalb das BMBF hier gezielt die Weiterentwicklung unterstützt hat.
Im Fokus aktueller Forschungsanstrengungen stehen zudem geeignete Produktionsorganismen. Während dies in den Anfängen der Biotechnologie zunächst Bakterien waren – wie beim Insulin – sind inzwischen überwiegend Säugetierzellen im Einsatz, wie CHO-Zellen, die ursprünglich aus Hamstern stammen, oder menschliche Zelllinien. Gegenüber Bakterien sind diese Zellen in der Lage, bestimmte, für die Wirkung von Medikamenten wichtige Moleküle herzustellen. Im Rahmen einer BMBF-Fördermaßnahme werden neue mikrobielle Biofabriken für die industrielle Bioökonomie gesucht, darunter viele für pharmazeutische Wirkstoffe wie Terpene oder Isoprenoide.
Das digitalisierte Biotech-Labor
Das Verbundprojekt DigInBio will die zukünftigen Möglichkeiten der Digitalisierung, Automatisierung und Miniaturisierung für die industrielle Biotechnologie aufzeigen und erschließen. Die Partner arbeiten in dem vom BMBF geförderten Projekt in drei digitalisierten Bioprozesslaboren und sind über ein zentrales Datenmanagement miteinander vernetzt. Im Fokus stehen unterschiedliche Schritte der Bioprozess-Entwicklung. Von intelligenten Software-Komponenten bis zur wissensbasierten Versuchsplanung, zur Ablaufsteuerung von parallel laufenden Laborexperimenten in Echtzeit bis zur Online-Datenauswertung, um in Zukunft die Bioprozessentwicklung drastisch verkürzen zu können. An DigInBio sind das Forschungszentrum Jülich, die TU München und Leibniz-Universität Hannover beteiligt.
Inzwischen werden aber auch unkonventionelle Organismen als biologische Arzneihersteller genutzt. So sind zum Beispiel Pflanzen als Produzenten innovativer Wirkstoffe ins Blickfeld gerückt. Bereits im Jahr 2012 hat die US-Zulassungsbehörde FDA ein in Karottenzellen produziertes Enzym zur Behandlung der Gaucher-Krankheit zugelassen. Auch in Deutschland wird an dem sogenannten Molecular Farming als Ansatz der Pflanzenbiotechnologie geforscht.
Wissenschaftlern des Fraunhofer-Instituts für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie in Aachen verwenden Tabakpflanzen als grüne Pharmafabriken. Sie haben eine automatisierte Anlage aufgebaut: Von der Aussaat, über die Kultivierung in einem Hochregalsystem mit kontrollierbarer Belichtung, Bewässerung und Düngung, bis hin zur Ernte und biotechnologischen Produktion erfolgen hier fast alle Schritte automatisiert. Basierend auf einem Verfahren des Hallenser Biotech-Unternehmen Icon Genetics soll mithilfe der Pflanzen ein neuer Krebsimpfstoff gegen Lymphdrüsenkrebs unter kontrollierten Bedingungen im Gewächshaus hergestellt werden. Ausgehend von Forschungsarbeiten, die von Pflanzenforschenden an der Universität Freiburg erfolgt sind, arbeitet die Biotech-Firma Eleva (ehemals Greenovation) wiederum an einem Produktionsverfahren für Medikamente auf der Basis des Kleinen Blasenmützenmooses Physcomitrium patens.
Es gibt Pflanzen, deren Inhaltsstoffe als medizinische Wirkstoffe von Interesse sind. So wird die Substanz Paclitaxel, die in der Pazifischen Eibe (Taxus brevifolia) vorkommt, als Krebsmedikament eingesetzt. Aufgrund der geringen Verbreitung der Pflanze und des niedrigen Wirkstoffgehalts, könnte der weltweite Bedarf an Paclitaxel auf herkömmlichem Wege allein nicht gedeckt werden.
Das Mittel wurde daher seit langem zusätzlich teilsynthetisch aus bestimmten pflanzlichen Wirkstoffvorstufen hergestellt. Im Jahr 2002 wurde vom britischen Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb ein Verfahren entwickelt, bei dem isolierte Eibenzellen auf Nährmedien in Fermentern kultiviert wurden, um den Wirkstoff zu gewinnen. Die biotechnologische Herstellung erfolgt im schleswig-holsteinischen Ahrensburg bei der Phyton Biotech GmbH, die eine der weltweit größten pflanzenzellbasierten Fermenterkapazitäten aufweisen kann.

Neben den modernen, biotechnisch erzeugten Pharmazeutika spielen auch heute noch traditionelle Arzneipflanzen eine wichtige Rolle. Der Anbau von heilenden Kräutern hat in Deutschland eine lange Geschichte. Insgesamt 440 Arzneipflanzen sind in Deutschland heimisch. Etwa 75 von ihnen werden hierzulande auf einer Fläche von rund 12.000 Hektar erwerbsmäßig angebaut, vor allem in Thüringen, Bayern, Hessen und Niedersachsen. Gemeinsam decken diese Länder mehr als 70 % des heimischen Arzneipflanzenanbaus ab. Den größten Anteil an der Gesamt-Anbaumenge hat die Kamille (mehr als 1.000 Hektar), gefolgt von Pflanzen wie Lein, Mariendistel, Pfefferminze und Sanddorn (jeweils 500 bis 1.000 Hektar). Der heimische Anbau stellt jedoch nur eine Nische dar: Etwa 85 % der verarbeiteten Arzneipflanzen werden importiert.
Vor allem Pflanzen, die nur in geringen Mengen eingesetzt werden oder die sich hierzulande nicht anbauen lassen, werden im Rahmen von Wildsammlungen an ihren natürlichen Standorten geerntet. Im Vergleich zum kommerziellen Landbau schwanken die Qualität und die quantitative Zusammensetzung ihrer Inhaltsstoffe. Daher wird versucht, auch weitere, bisher nicht angebaute Pflanzen in Kultur zu nehmen. Leicht ist das jedoch nicht. So dauert es bei Kräutern mindestens fünf Jahre, bei Gehölzen teils noch länger, um die Pflanzen für den Erwerbsanbau fit zu machen. Daher unterstützt das BMEL entsprechende Forschungsarbeiten.