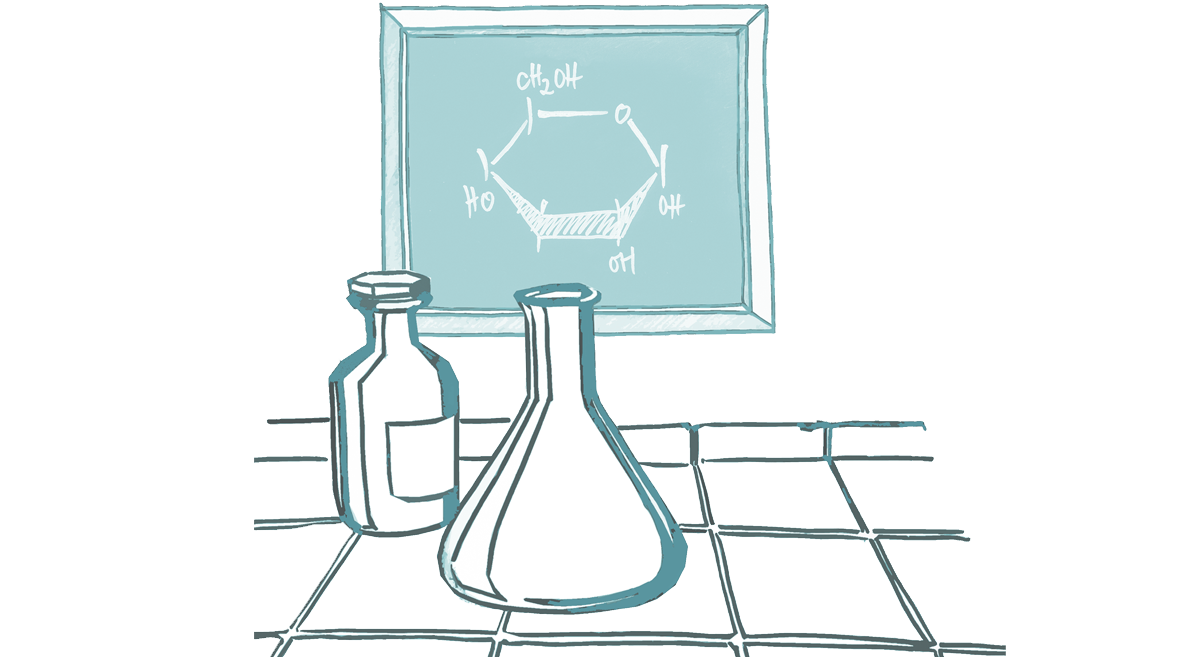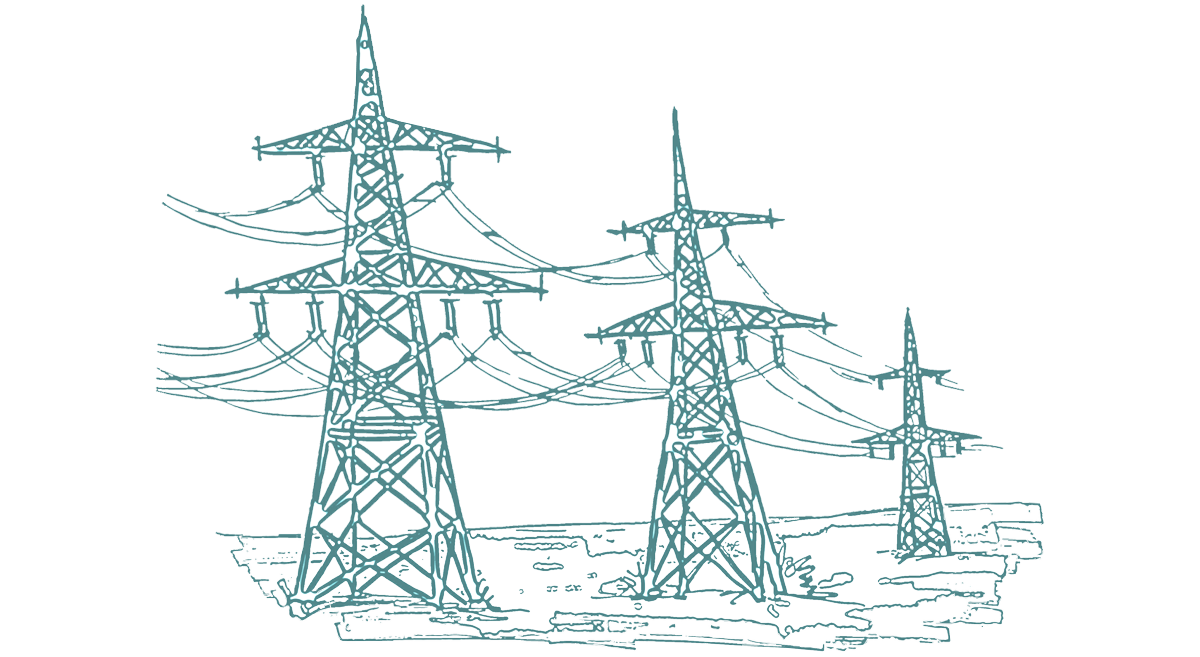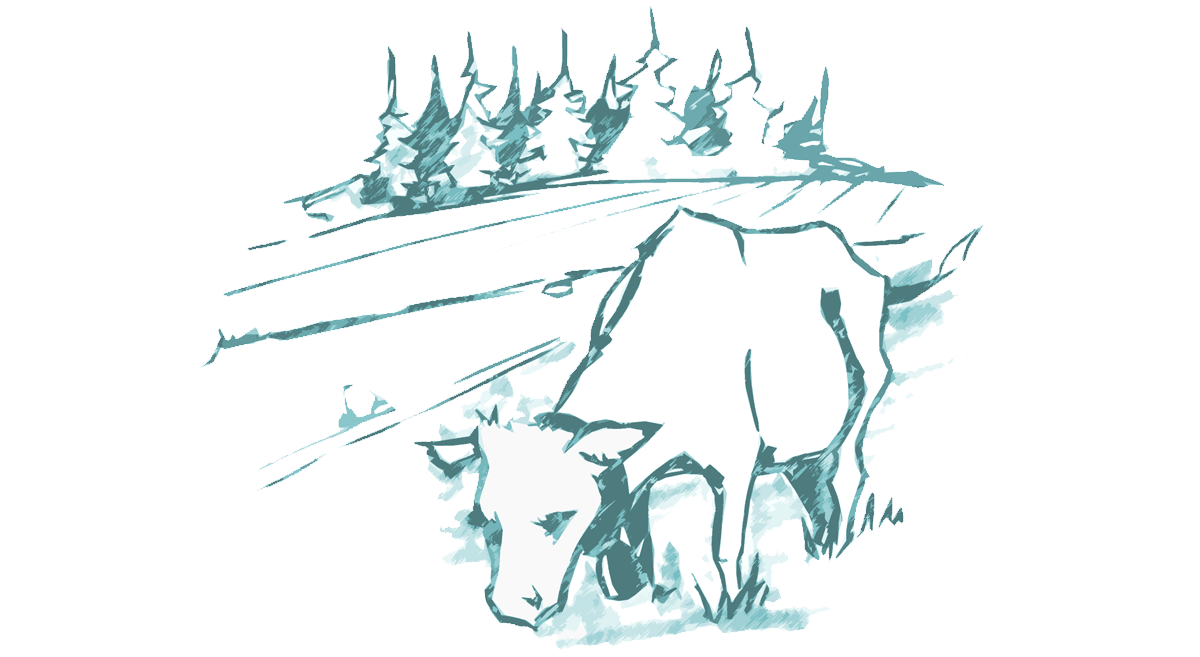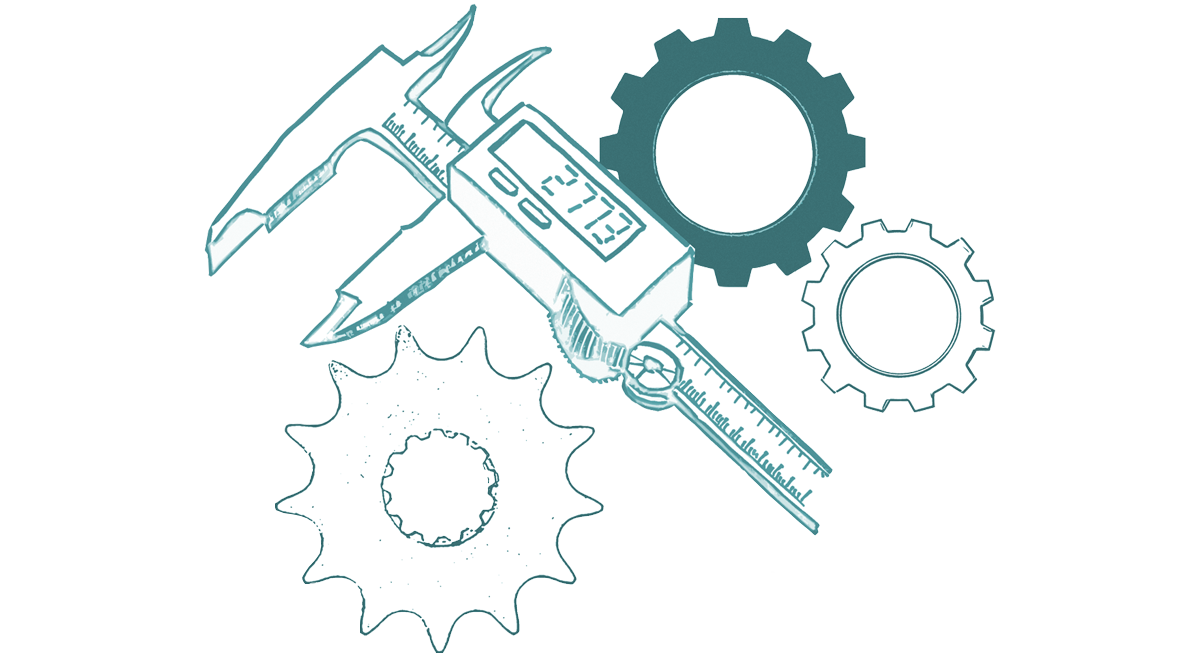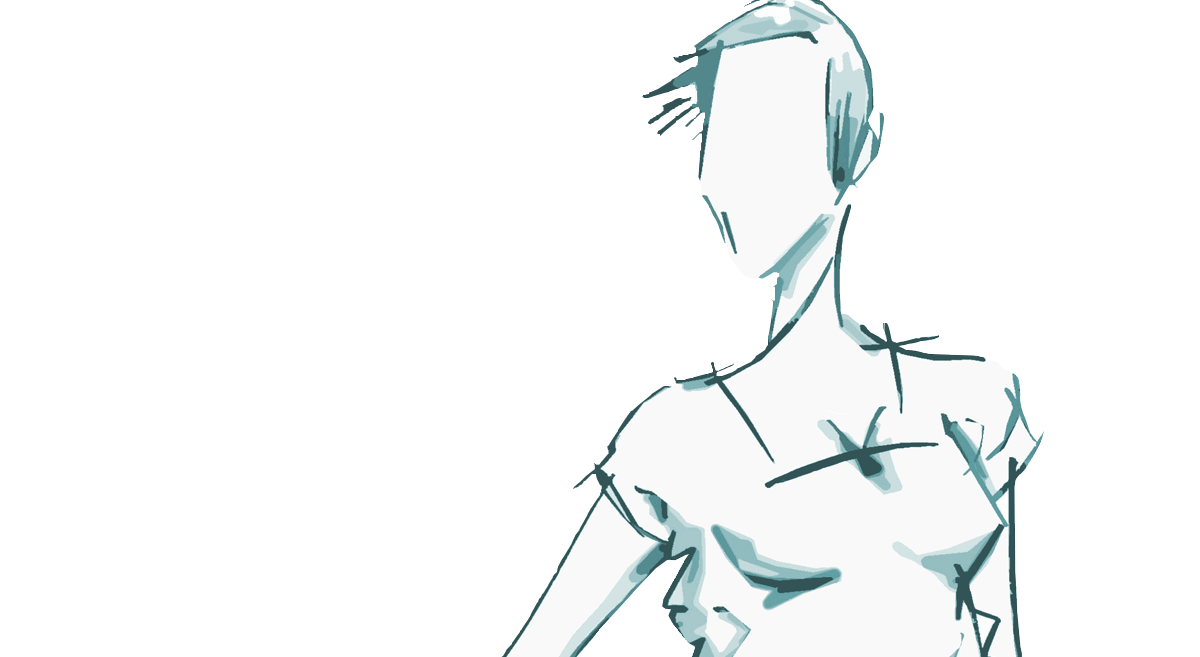Automobil
Das Auto ist auch in Zukunft wichtiger Baustein der Mobilität. Mit Blick auf Klimaziele und internationale Wettbewerbsfähigkeit sind alternative Antriebstechnologien gefragt. Die Hersteller setzen auf Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe, um immer leichtere Fahrzeuge zu bauen, Ressourcen zu schonen und eine Kreislaufwirtschaft zu realisieren.
Beispiele aus der Bioökonomie:
Naturfaserverstärkte Karosserieteile,
Innenverkleidung aus Biokunststoff,
Reifen aus Löwenzahn

Der Verkehrssektor ist für rund ein Fünftel der deutschen Treibhausgas-Emissionen verantwortlich, davon gehen wiederum mehr als 95 % auf das Konto des Straßenverkehrs. Auf dem Weg zur Klimaneutralität steht der Mobilitätssektor vor einem grundlegenden Wandel. Mittendrin in dieser Transformation: das Auto. In Deutschland gab es nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes 2023 mehr als 49 Mio. zugelassene Pkw. Die Zahl der E-Pkw ist noch niedrig. Ihr Anteil am Pkw-Bestand liegt bei 2,1 %.
Einer der wichtigsten Treiber des Strukturwandels in der Automobilindustrie ist die Umstellung auf alternative Antriebstechnologien. Eindeutig im Fokus der Branche stehen Elektromotoren, die entweder durch Batterien oder Wasserstofftechnologien (Brennstoffzellen) angetrieben werden. Doch klar ist auch, dass der Verbrennungsmotor zumindest in Teilen der Automobilbranche auch in Zukunft eine Rolle spielt. Das gilt insbesondere bei Nutzfahrzeugen mit großer Reichweite oder solchen, die im Gelände abseits von Straßen unterwegs sind – also etwa in der Landwirtschaft. Als grüne Kraftstoffe kommen hier unter anderem Biokraftstoffe infrage oder synthetische Kraftstoffe (vgl. Energie).
Erdöl wird hier nicht nur in Form von Benzin, Diesel oder Schmierstoff gebraucht, sondern auch als Ausgangsstoff für viele Autoteile genutzt – angefangen vom Autolack über weite Teile des Interieurs, elektronische Bauteile bis hin zu Displays. Heute gehen etwa 10 % der Kunststoffe, die jährlich in Deutschland produziert werden, in die Automobilindustrie. Dies liegt vor allem daran, dass diese Materialien leicht, gut formbar sind und eine gute Wärme- und Geräuschdämmung aufweisen. Aber auch Hybridteile, die aus Metall und Kunststoff zusammengesetzt sind, kommen zum Einsatz. Einige Kunststoffe sind sogar so robust, dass sie als Ersatz für Metall dienen.
Ressourceneffizienz, Leichtbau und Kreislaufwirtschaft sind Topthemen in der Fahrzeugindustrie. Nicht nur, um ressourcensparende Fahrzeuge zu konstruieren, sondern auch um Produktionsprozesse nachhaltiger zu gestalten, rücken bei den Autobauern immer stärker biobasierte Alternativen in den Fokus. Im Interieur und bei der Karosserie kommen Pflanzenfasern, biobasierte Kunststoffe sowie naturfaserverstärkte Verbundwerkstoffe für den Leichtbau zum Einsatz.
Die Verwendung von Naturfasern hat im Automobilbau Tradition. Armauflagen, Gepäckraum-Ladeböden und Isolierungen werden daraus gefertigt. Fasern aus Kokosnuss, Rüben oder Kaffeesatz lassen sich als Füllstoffe nutzen. Bei der Herstellung des Armaturenbretts und des Innenraums – etwa in Kofferraum und Türen – nutzen Autobauer Naturfasern hingegen als Verstärkungsmaterial für Leichtbauteile und die Fahrzeugkarosserie. Ein Pluspunkt der Werkstoffe aus Flachs, Sisal und Co. ist ihre geringe Splitterneigung, die bei der Verarbeitung und beim Auftreten von Unfällen von Vorteil ist. In solchen Bioverbundwerkstoffen sind Pflanzenfasern in eine Kunststoffmatrix eingebettet, die erdölbasiert oder biobasiert sein kann.
Im Jahr 2018 wurden nach Zahlen des nova-Instituts etwa 150.000 Tonnen solcher Bioverbundwerkstoffe im europäischen Automobilsektor verbaut. Zum Beispiel erprobt die Volkswagentocher Seat in einem Pilotprojekt einen Bioverbundwerkstoff namens Oryzite, der aus Reishülsen, Polyurethan und Polypropylen besteht. Dieser Werkstoff soll in Heckklappen, im Ladeboden oder im Dachhimmel zum Einsatz kommen.
Autohersteller setzen zudem auf Biokunststoffe. Hierbei handelt es sich entweder um sogenannte Drop-in-Lösungen oder neuartige und biologisch abbaubare Biokunststoffe (vgl. Chemie). Biobasierte Polyamide aus Rizinusöl werden in Hochleistungsbauteilen eingesetzt, Polymilchsäure (PLA) in Türinnenverkleidungen, sojabasierte Schäume in Sitzpolstern und Armlehnen. Eine Herausforderung beim Einsatz von Biokunststoffen im Automobilbau liegt in ihrer Verarbeitungsfähigkeit. Entsprechend widmen sich viele Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Frage, wie bestehende Spritzgussverfahren für die Herstellung von biobasierten Autoteilen angepasst werden können. Auch die Recyclingfähigkeit von Biokunststoffen wird immer intensiver erforscht.
Selbstheilender Lack auf Maisstärke-Basis
Selbstheilende Lacke werden in der Nanotechnologie seit mehr als einem Jahrzehnt entwickelt. In einem vom BMBF geförderten Projekt haben Saarbrücker Forschende vom Leibniz-Institut für Neue Materialien mit der Universität des Saarlandes einen selbstheilende Fahrzeuglack entwickelt. Sie verwendeten ringförmige Abkömmlinge der Maisstärke, sogenannte Cyclodextrine, die zu einer Kette aufgefädelt sind. Bei Wärme sind sie beweglich und können oberflächliche Kratzer ausgleichen. Auch die Universität Paderborn hat mit der PPG Hemmelrath Lackfabrik an einem biobasierten, kratzfesten und selbstheilenden Lack geforscht. Gefördert wurden sie vom BMEL.
Eine ungewöhnliche Allianz aus einem Rennsport-Team, Sportwagenbauenden und Materialforschenden steht hinter dem „Bioconcept-Car“. Bereits seit mehr als 15 Jahren gibt es dieses Projekt des Reutlinger Rennsportteams Four Motors, zu dem unter anderem Sänger Smudo von den Fantastischen Vier gehört. Das Ziel: Rennwagen konstruieren und erproben, die zu großen Teilen aus Biowerkstoffen gebaut sind und mit Biokraftstoffen fahren.

Gefördert vom BMEL sind aus dem Projekt seit 2003 sieben Konzeptautos hervorgegangen, die im Alltag über die Teststrecke auf dem Nürburgring brettern. Aktuell fährt Four Motors Rennwagen von Porsche. Der Stuttgarter Autohersteller verbaut bereits seit 2019 naturfaserverstärkte Kunststoffe in einer Kleinserie des Cayman GT4 Clubsport. Für die Bioconcept-Cars wurden Bioverbundwerkstoffe mit einem Anteil nachwachsender Rohstoffe von 30 bis 70 % sowie Biokunststoffteile als Karosserie- und Interieurbauteile entworfen, hergestellt und montiert. Das ist nicht nur ökologisch nachhaltiger: Die Naturfasern aus Flachs sind leichter als Glasfasern und kostengünstiger als Carbonfasern. Forschende vom Fraunhofer-Institut für Holzforschung (WKI) haben in einem Forschungsverbund nicht nur Biohybrid-Leichtbauteile für das Bioconcept-Car entwickelt. Nun wollen die Fraunhofer-Forschenden gemeinsam mit den Kooperationspartnern Hobum Oleochemicals GmbH, Porsche Motorsport und Four Motors eine Fahrzeugtür mit einem biogenen Anteil von 85 % im Gesamtverbund aus Fasern sowie Harz und Lack entwickeln.
Gummi ist ein gefragter Werkstoff, dessen Herstellung sowohl petrochemisch als auch auf der Basis von Naturkautschuk erfolgen kann. Letzterer wird aus dem Milchsaft des Kautschukbaums (Hevea brasiliensis) gewonnen – vor allem in Plantagen in Südostasien. Naturkautschuk bleibt auch bei tiefen Temperaturen elastisch und steht bei Herstellern von Winterreifen deshalb hoch im Kurs. Doch für den Anbau müssen Waldflächen weichen und lange Transportwege sorgen für einen hohen Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß.
Eine alternative Quelle ist der Russische Löwenzahn (Taraxacum koksaghyz). Er gedeiht auch in unseren Breiten gut. Der Kautschuk aus dem Milchsaft der Wurzeln hat das gleiche Molekulargewicht und die gleiche Elastizität wie der vom Kautschukbaum und lässt sich auch genauso verarbeiten. Seit vielen Jahren erproben Forschende aus Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam, wie sich Löwenzahn zum industriellen Lieferanten für Kautschuk wandeln lässt. Federführend sind Pflanzenforschende der Universität Münster, des Fraunhofer IME und der Reifen-Konzern Continental.

Sowohl das BMBF als auch das BMEL sowie die Europäische Union und das Land Mecklenburg-Vorpommern haben die Forschung und Entwicklung zur industriellen Nutzung von Löwenzahn-Kautschuk umfangreich gefördert. Dabei geht es um die Gestaltung der gesamten Wertschöpfungskette: Durch moderne Verfahren der Präzisionszüchtung sollen deutlich ertragreichere und robustere Gewächse entstehen. Außerdem geht es in der Allianz darum, die Verarbeitungsschritte und die Gewinnung der Pflanzenrohstoffe zu verbessern und nachhaltig zu gestalten.
Für Hersteller Continental ist der Naturkautschuk aus Löwenzahn zu einem wichtigen Bestandteil seiner Nachhaltigkeitsstrategie geworden. 2014 wurden die ersten Taraxagum-Testreifen für Pkw gefertigt und erprobt, zwei Jahre später folgten Lkw-Reifen. Im Jahr 2018 eröffnete Continental dann in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern das „Taraxagum Lab“ als Forschungs- und Entwicklungslabor. Hier wurde auch das erste im Handel erhältliche Produkt entwickelt, das seit 2019 vermarktet wird: ein Fahrradreifen.