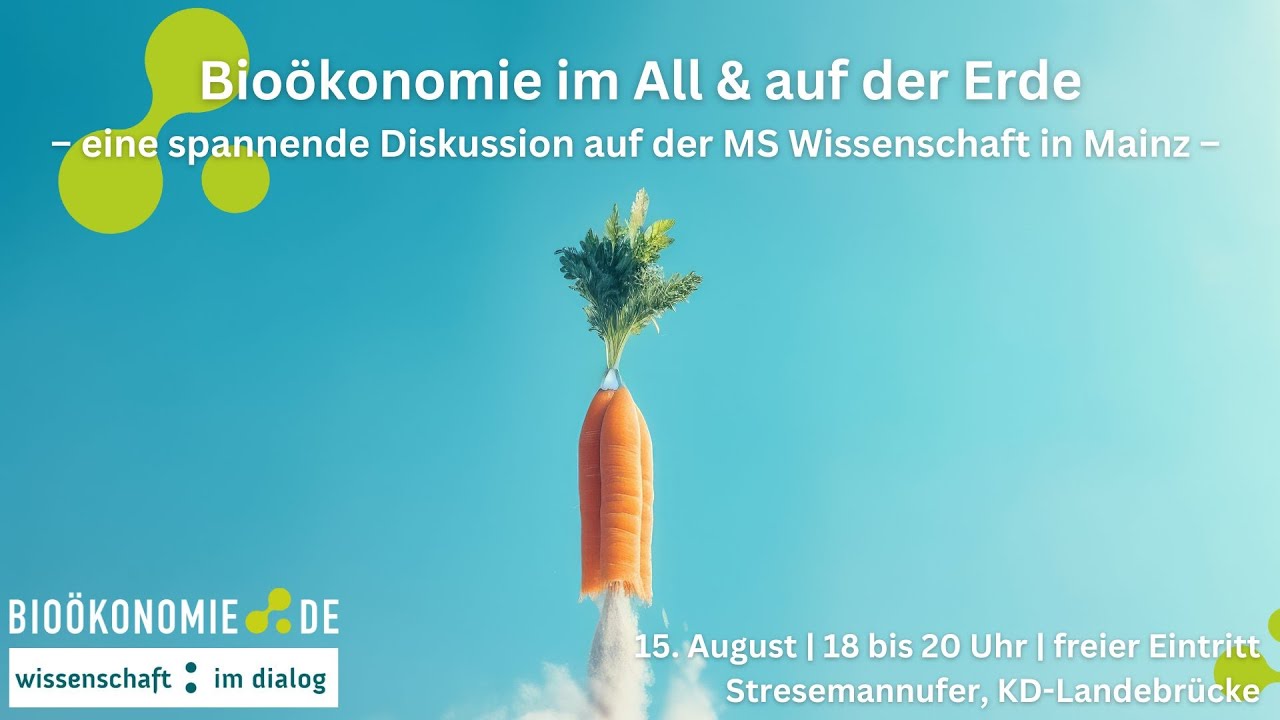Forschung an Löwenzahnkautschuk geht voran
Im Projekt TAKOWIND ist es einem Konsortium unter Leitung des Pflanzenzuchtbetriebes ESKUSA GmbH gelungen, den Anteil des Kautschuk-Gehalts im russischen Löwenzahn deutlich zu erhöhen.

Traditioneller Naturkautschuk wird bislang ausschließlich in Gummibaumplantagen in Indonesien und Malaysia gewonnen. Neben langen Transportwegen ist der Anbau mit der Rodung von Regenwald, einem hohen Wasserverbrauch und dem Verlust von Artenvielfalt verbunden. Schon seit 2000 wird daher auch in Deutschland intensiv an einer alternativen Kautschukquelle für die Automobilindustrie geforscht. Im Fokus steht der russische Löwenzahn.
Ausbau heimische Kautschukproduktion gut Wirtschaft
Im Rahmen des Verbundprojektes TAKOWIND werden Züchtung und Anbau des alternativen Kautschuklieferanten seit Jahren vom Bundeslandwirtschaftsministerium gefördert. Ziel ist es, die Wildpflanze als Rohstoff für die Industrie – und insbesondere für die Autoindustrie nutzbar zu machen. „Wenn wir die heimische Produktion ausbauen können, ist das gut für unseren Wirtschaftsstandort und unsere Landwirtschaft. Deshalb unterstützt mein Haus entsprechende Forschungsprojekte“, sagt Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer bei einem Besuch der ESKUSA GmbH in Parkstetten.
Im Rahmen des Verbundvorhabens TAKOWIND arbeitet die ESKUSA gegenwärtig mit der Universität Münster, dem Julius-Kühn-Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI) und dem Biotechnologieunternehmen ScreenSYS GmbH daran, den Löwenzahnkautschuk im großen Stil zu gewinnen und zu vermarkten. „Aktuell liegt der Kautschuk-Ertrag pro Hektar bei ca. 150 kg“, berichtet Fred Eickmeyer, Gründer und Betriebsleiter des Pflanzenzuchtbetrieb ESKUSA. „Wirtschaftlich interessant wird der Anbau, wenn wir einen Ertrag von 1.000 kg Kautschuk pro Hektar erzielen“. Aus 1.000 kg Löwenzahnkautschuk könnten demnach 500 Autoreifen hergestellt werden.
Kautschukgehalt im Löwenzahn deutlich gesteigert
Projektleiter Fred Eickmeyer ist optimistisch, das Ziel „in absehbarer Zeit“ zu erreichen. „Zu den bisherigen züchterischen Erfolgen gehört ein von drei auf 16 % gesteigerter Kautschuk-Gehalt in der Löwenzahnwurzel“, berichtet Eickmeyer. Bei der Weiterentwicklung des Löwenzahnkautschuks arbeitet das TAKOWIND-Team eng mit dem Reifenhersteller Continental zusammen. Das Unternehmen treibt seit 2011 mit Forschenden der Universität Münster und dem Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie IME die Nutzung des Löwenzahns. Erste Prototypen eines Autoreifens wurden bereits produziert. Auch Fahrradreifen konnten in einer Kleinserie hergestellt werden.
bb