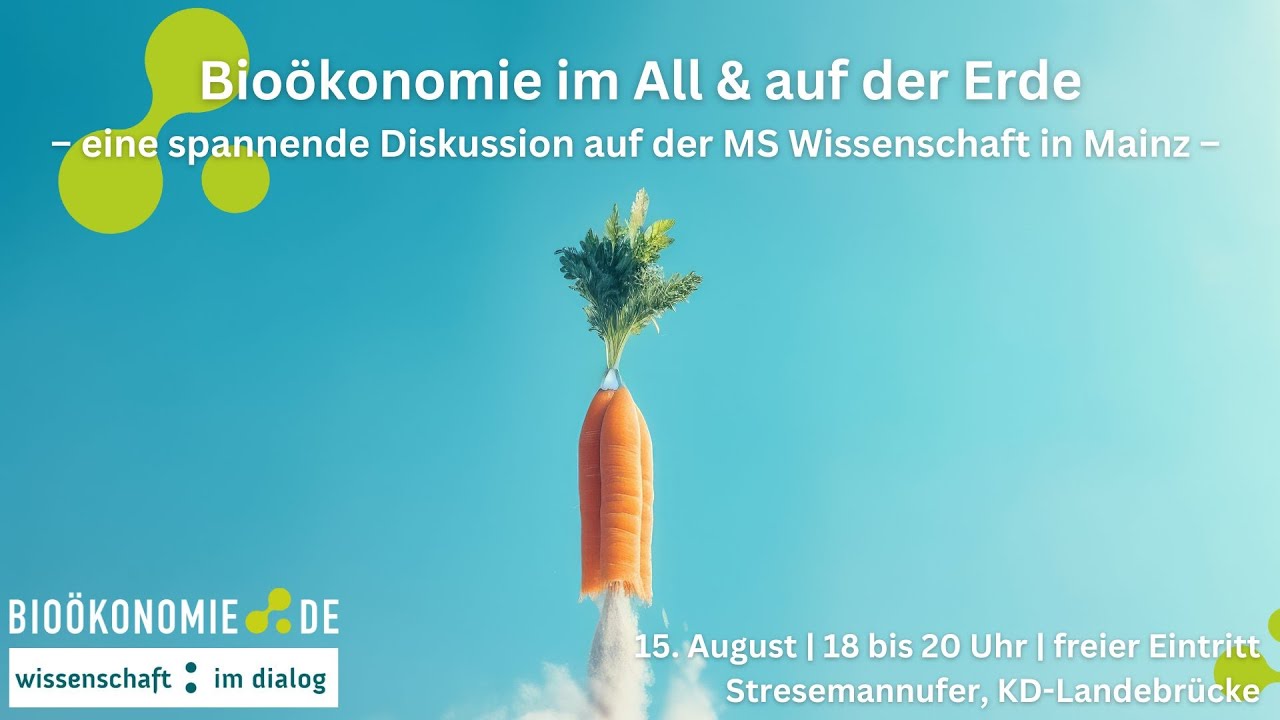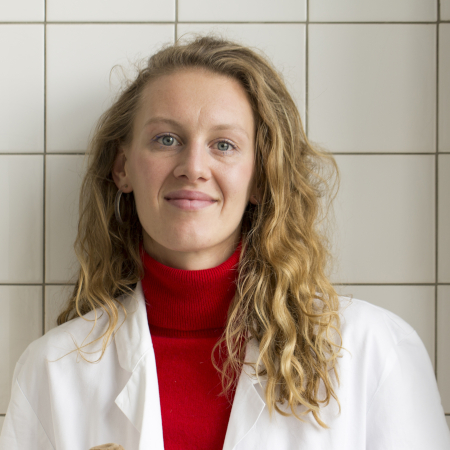Pilze sind längst mehr als nur ein Lebensmittel. Aus ihnen lassen sich neben Käse und Bier auch Enzyme und Biokraftstoffe – und sogar Textilien, Möbel sowie Baustoffe herstellen. Ihr unterirdisches Geflecht von Pilzfäden macht sie zu vielversprechenden Kandidaten, um nachhaltige, biologisch abbaubare Materialien herzustellen. Trotz ihres enormen Potenzials stecken pilzbasierte Innovationen jedoch oft noch in der Nische.
„Der Knackpunkt ist nicht, die Pilze wachsen zu lassen. Die Herausforderung liegt darin, das Ganze in einen wirtschaftlichen Industrieprozess zu überführen. Genau dieser Aufgabe haben wir uns verschrieben, um marktfähige Lösungen zu schaffen“, so Willy Hammer, Gründer und Geschäftsführer der 2021 gegründeten Hammer GmbH in Lauingen und Leiter des Projekts MyDaemm.
Prozesskette zur industriellen Herstellung pilzbasierter Dämmstoffe
Im Rahmen des zweijährigen Vorhabens hat das Start-up gemeinsam mit Forschenden vom Mikrobiologischen Institut der TU Berlin und dem Unternehmen Erfurt & Sohn KG in Wuppertal an einem industrialisierungsfähigen Produktionsprozess zur Herstellung nachhaltiger Dämmstoffe auf Basis von Pilzmyzelien sowie Reststoffen aus der Industrie und Landwirtschaft gearbeitet. Die Hammer GmbH wurde dabei vom Bundesforschungsministerium im Rahmen der Fördermaßnahme „KMU-innovativ“ von Dezember 2022 bis Dezember 2024 mit rund 326.000 Euro unterstützt.
Ziel des Projektes war es, eine Prozesskette zu etablieren, die alle wichtigen Schritte – von der Anzucht der Pilze über die Lagerung und Trocknung bis hin zur industriell skalierbaren Fertigung des nachhaltigen Baustoffs – bedient. Für die Entwicklung der Prozesskette war das Lauinger Unternehmen verantwortlich.
Eine Datenbank für regionale Roh- und Reststoffe
Zur Herstellung des pilzbasierten Dämmstoffes nutzte das Team das Myzel des Zunderschwamms. Hier brachten die Forschenden der TU Berlin ihre Erkenntnisse aus der jahrelangen Forschung an pilzbasierten Materialien und insbesondere bei der Kultivierung des Zunderschwamms ein. Bei der Züchtung von Pilzmyzel wurde zudem auf den Einsatz regionaler Reststoffe gesetzt, die dem Pilz als biogenes Substrat zum Wachstum dienen.
„Die Nachhaltigkeit der Reststoffe und sie im Kreislauf zu führen, war uns wichtig. Deshalb haben wir uns auf lokale Rohstoffe im Umkreis von 100 Kilometern fokussiert, die auch ganzjährig verfügbar sind“, berichtet Willy Hammer. Das Start-up hat dafür extra eine Datenbank aufgebaut, die heute schon über 26 Roh- und Reststoffe aus der Landwirtschaft enthält. Auf dieser Grundlage wurde die Rezeptur des pilzbasierten Materials fortlaufend optimiert und es entstanden Versuchsmuster.
Als Trägermedium dienten schließlich Hanfschäben. Sie waren regional und in ausreichender Menge verfügbar und erwiesen sich auch in den Laborversuchen als eine gute Nährstoffquelle für den Pilz. „Hanfschäben enthalten unter anderem Cellulose, die der Pilz gut abbauen kann. Sie sind locker, porös und leicht und daher ideal für die Sauerstoffversorgung im Myzelwachstum.“
Dämmplatte aus Hanfschäben und Industriereststoffen
Doch nicht nur Hanfschäben kamen zum Einsatz. Dem Dämmstoff wurden auch 30 % Industriereststoffe beigemischt, um den Werkstoff günstiger zu produzieren. Zudem wurde eine Trennschicht entwickelt, die in Dämmstoffen auch zur Stabilisierung der eigentlichen Dämmschicht dient. Diese wurde so gestaltet, dass der Baustoff am Ende des Lebenszyklus sortenrein von Beschichtungen wie Putz oder Farben getrennt werden kann. „Damit bringen wir den Dämmstoff in die Kreislauffähigkeit und gewährleisten seine Recyclingfähigkeit unabhängig von der jeweiligen Verarbeitung durch den Endanwender. Dieser Ansatz führt nicht nur zu einem marktfähigen und nachhaltigen Baustoff, sondern verbessert zugleich den ökologischen Fußabdruck“, erklärt der Projektleiter.
Auch wurden zur weiteren Wirtschaftlichkeit des Produkts Reststoffe beigemischt, die ansonsten in die thermische Verwertung gegangen wären. „Diese Reststoffe wurden von dem Unternehmen Erfurt & Sohn bereitgestellt, sodass wir ihnen im Myzel-Dämmstoff einen zweiten Lebenszyklus schenken konnten.“
Mit KI Herstellungsprozess designen
Bei der Entwicklung einer nachhaltigen und zugleich effizienten Prozesskette stieß das Forschungsteam auf so manche Hürde. Ein Problem war beispielsweise der Grad der Verunreinigung, etwa durch Pestizide. Daneben behinderte eine zu hohe Restfeuchte der Substrate bei der Anlieferung die Lagerfähigkeit. „Deshalb haben wir uns primär mit Hanfschäben auf einen Stoff fokussiert, der sich schon bewährt hat“, so Hammer. Eine weitere Herausforderung war, den Prozess auch wirtschaftlich zu gestalten. „Dafür haben wir eine KI entwickelt, die auf dem Design-of-Experiment-Modell basiert, um den Prozess begreifbar und nachvollziehbar zu machen. So konnten wir etwa vergleichen, bei welcher Temperatur und CO₂-Konzentration das Myzel im Bioreaktor am schnellsten wächst.“ Für ein optimales Pilzwachstum entwickelte das Start-up nicht nur ein KI-Modell, sondern auch einen eigenen neuartigen kostenoptimierten Bioreaktor.

Prozesskette zum Patent angemeldet
Nach zwei Jahren Forschung konnte das MyDaemm-Team eine industrialisierungsfähige Prozesskette zur Herstellung pilzbasierter Dämmstoffe vorweisen – einschließlich einer pilzbasierten Dämmplatte als Demonstrator, die nach Angaben des Projektleiters in puncto „Wärmeleitfähigkeit vergleichbar mit herkömmlichen Dämmstoffen ist“. Das neu entwickelte Verfahren hat die Hammer GmbH zum Patent angemeldet. Willy Hammer ist überzeugt: „Mit unserem neuartigen, zum Patent angemeldeten Produktionsprozess haben wir ein Ass im Ärmel gegenüber dem Stand der heutigen Technik.“
Noch liegen allerdings die Herstellungskosten für die entwickelten Myzel-Dämmstoffe rund 25 bis 30 % über dem Preis herkömmlicher, rohölbasierter Dämmstoffe. Aber Willy Hammer ist davon überzeugt: „Im Rahmen der weiteren Skalierung und Industrialisierung schaffen wir ein wettbewerbsfähiges Produkt.“
Bau einer modularen Pilotanlage geplant
Als Nächstes plant das Lauinger Unternehmen den Bau einer Pilotanlage. Die Vorbereitungen laufen bereits. „Wir wollen die Pilotanlage modular aufbauen, wie Legobausteine, die man ergänzen kann, um die Kapazität zu erhöhen. Denn das großartige ist, dass man das Material ja auch für andere Produkte wie Satelliten und Faserplatte nutzen kann.“ Mit einer eigenen Forschungshalle ist das Start-up zudem gut gerüstet, um die Entwicklung innovativer Materialien auf Pilzmyzelbasis weiter voranzutreiben.
Autorin: Beatrix Boldt