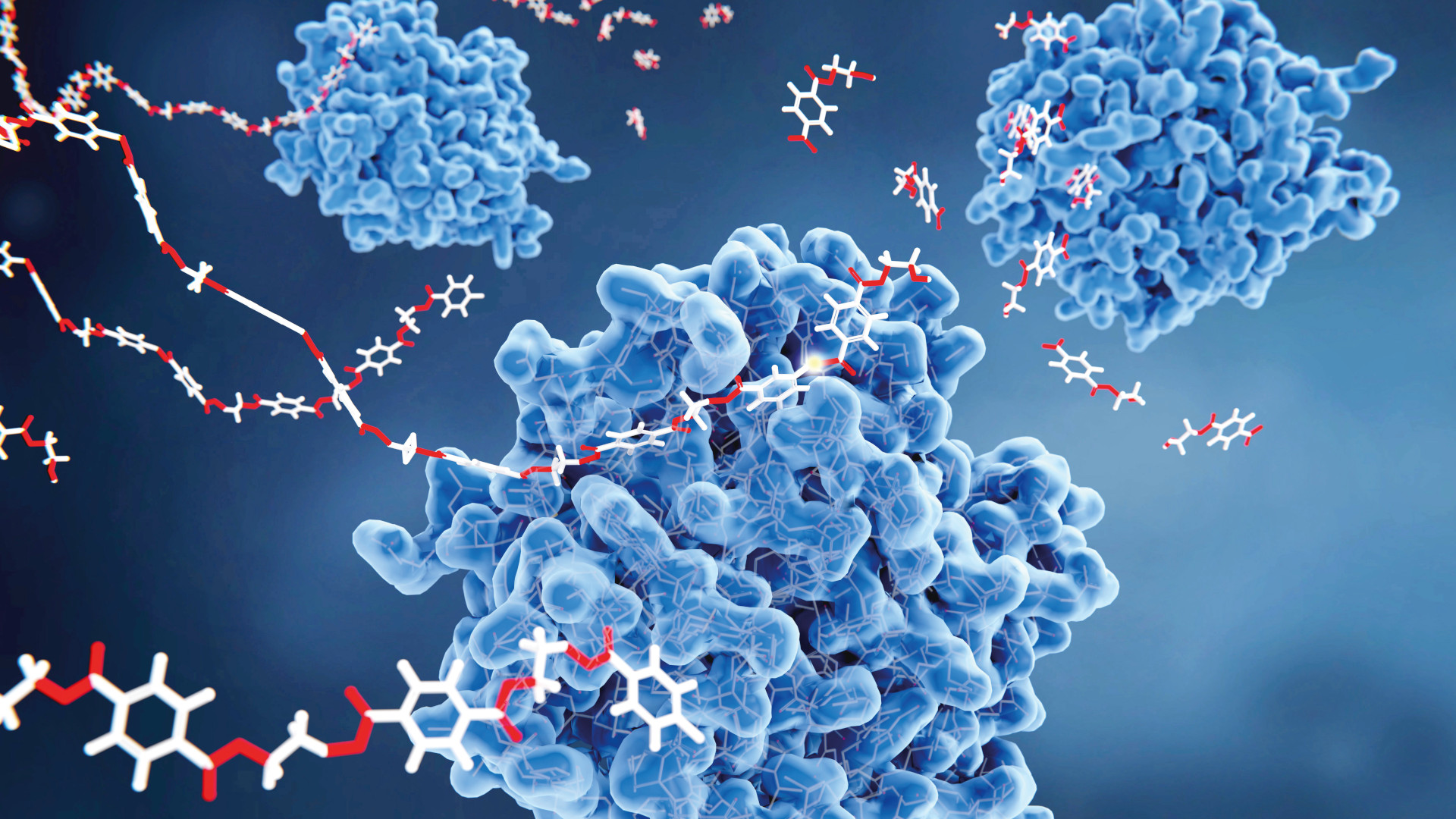Bioökonomie erleben: Biofunktionsbausteine für nachhaltige Materialien
In unserem Format „Bioökonomie erleben“ ist Reporterin Margarita zu Besuch bei Professor Ulrich Schwaneberg an der RWTH Aachen und zeigt, wie sich Materialien entwickeln lassen, die wasserabweisend, funktional und gleichzeitig umweltfreundlich sind.
Viele Alltagsprodukte – vom Einweggeschirr bis hin zu Medizintechnischen Produkten und Autos – enthalten Materialien auf Erdölbasis. Sie sind praktisch und oft notwendig, aber nicht nachhaltig. An der RWTH Aachen wird an alternativen Lösungen geforscht, die auf sogenannten Biofunktionsbausteinen basieren. Wie lassen sich Materialien entwickeln, die wasserabweisend, funktional und gleichzeitig umweltfreundlich sind? Professor Ulrich Schwaneberg zeigt, wie Proteine gezielt verändert und eingesetzt werden können, um nachhaltige Eigenschaften zu erzeugen. Wissenschaftsredakteurin Margarita erhält Einblicke in die biotechnologische Forschung, erfährt mehr über die Funktionsweise von Biofunktionsbausteinen und welches Potenzial sie für die Entwicklung ressourcenschonender Materialien besitzen.
Video Transkript
Unser Alltag wird bestimmt von Materialien, die praktische Eigenschaften besitzen, wie zum Beispiel dieses Einweggeschirr hier, dessen Oberfläche wasserabweisend ist. Wie das genau funktioniert, wissen wir oft nicht. Meistens jedoch stecken Verbindungen aus Erdöl dahinter und nachhaltig ist das nicht. Deshalb sind wir heute mit Bioökonomie erleben an der RWTH Aachen, wo nach umweltfreundlichen Alternativen gesucht wird. Woraus die genau bestehen und wie sie entwickelt werden, das zeigt mir jetzt Professor Ulrich Schwaneberg vom Lehrstuhl für Biotechnologie.
Hallo Professor Schwaneberg, wie schön, Sie zu treffen.
Hallo, Margarita. Schön, dass du heute bei uns an der RWTH bist. Um zu sehen, was man mit Proteinen und Biofunktionsbausteinen alles machen kann.
Ja, ich sehe, Sie haben hier schon sehr, sehr viel vorbereitet. Was sehe ich denn hier alles?
Ja, greif einfach mal rein. Und was dich interessiert.
Das sieht aus wie ein Protein.
Ja, genau. Das ist ein Protein mit einer schönen dreidimensionalen Struktur, um das zu visualisieren. Und du musst Dir vorstellen, diese Proteine sind 5 bis 10 Nanometer groß, also unheimlich klein.
Okay, das ist eine ganz andere Größenordnung. Und was kann man mit diesen Proteinen machen? Was haben Sie zum Beispiel mit diesem Teller hier zu tun?
Das ist hier ein Teller, der ist aus Zuckerrübenpektinen gemacht, das sind nachwachsende Rohstoffe, und da ist eine Beschichtung drauf damit man von dem Teller essen kann, die wasserabweisend ist. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem Konzert und die Leute schmeißen Sachen weg in die Umwelt und dann ist das aber komplett bioabbaubar und kompostierbar.
Das ist natürlich sehr praktisch und solche Beschichtungen gibt es also auch für andere Anwendungen. Ja. Was ist das hier für eine Beschichtung?
Das ist auch ein Metall und zwar im Flugzeugbau ist es immer noch so, dass Risse, die Du hier siehst, die werden immer noch visuell detektiert. Ja, und was wir jetzt machen können, ist, wir können so ein Protein nehmen, das ist sogar dieses Protein, das sieht sogar so aus. Ja. Bringen das dann an die Oberfläche drauf, waschen das einmal ab und dann bleibt es nur an dem Material von den Rissen gebunden und dann fluoresziert’s dort.
Und wie schneidert man solche Proteine?
Also ich nehme hier einfach mal eins raus. Sind zwei Verfahren, die man dafür braucht Vielfaltsgenerierung und Durchmusterung. Und das schauen wir uns am besten im Labor an. Perfekt.
Ihnen nach.
Was in der Natur unvorhersehbar und langwierig sein kann, lässt sich im Labor längst beschleunigen. Proteindesign heißt hier gezielt Vielfalt zu erzeugen und mit modernen Methoden wieder einzuschränken. So entstehen aus unzähligen Möglichkeiten genau die Varianten, die für neue Materialien spannend sind.
Und im erste Schritt werden ja in einer Million Varianten innerhalb von wenigen Stunden generiert im Proteinengineering. Und dann werden aus diesen Millionen Varianten die besten paar 100 rausgefischt über Fluoreszenz. Und die kommen dann in solche Mikrotiterplatten und man beschleunigt damit sozusagen die natürliche Evolution millionenfach.
Je nachdem, welche Funktion man braucht, wasserabweisend, klebend oder eben fluoreszierend, werden diese Proteine für die jeweilige Anwendung ausgewählt. Am Beispiel der Metallplatte aus dem Flugzeugbau, die wir vorhin gesehen haben, zeigt sich das besonders eindrucksvoll. Sogar winzige Risse, die mit bloßem Auge kaum erkennbar sind, werden durch ein passendes Protein unter dem Fluoreszenzmikroskop sichtbar gemacht. Solche schnellen und genauen Methoden zur Detektion sind nicht nur für Flugzeuge entscheidend, sondern auch für die sicherheitskritischen Bereiche wie Windräder, Brücken und Autokarosserien.
Überall dort, wo Materialschäden rechtzeitig erkannt werden müssen, bevor sie gefährlich werden. Das sind die Risse, die wir aber auch in echt gesehen haben. Nur wahrscheinlich hätte man die Enden nicht so ganz weit gesehen.
Teilweise hast du sie gesehen, aber manche waren ja auch sehr dünn, die man eigentlich im Auge nicht mehr gesehen hätte.
Doch das ist nur eine von vielen möglichen Anwendungen dieser Peptide. Am DWI, dem Leibniz Institut für interaktive Materialien, wird an weiteren Funktionen gearbeitet, wie zum Beispiel an Schaltbaren Klebern, die sich auf Kommando wieder lösen. Bei einem Zugfestigkeitstest kann ich mich von der Klebeleistung selbst überzeugen. Wow. Und wie funktioniert das? Wie kann es sein, dass so ein Kleber so stark ist?
Wir haben dort ein Protein drauf und das klebt dann zusammen. Und wenn man das nimmt, das kann man jetzt nicht nur für solche Kleber mit Glas verwenden, sondern wenn man hier so ein Tetra Pak hat, dann hat man hier auch ein Aluminium und da ist ein Polypropylen drin. Das ist ganz schwierig zum Trennen. Und wenn man das in Wasser rein schmeißt über Nacht wartet, dann sieht man hier eine Aluminiumfolie und hier ist die Polypropylenfolie und dann ist das vollständig getrennt.
Also das ist ein Wasserschalter und solche Schalter-Systeme, mit Strom, mit Licht, mit Salz, mit Enzymen. Das ist das, was wir hier entwickeln.
Ja.
Und wenn du mutig bist, kannst du dir diesen Proteinkleber sozusagen mal zwischen die Finger tun. Mal sehen. Wenn der trocknet, wird der erste fest, dass er so ein bisschen Fäden zieht. Und dann kannst du es auch gleich wieder mit Wasser hier wieder abwaschen.
Das ist also nachhaltig im Sinne von biologisch abbaubarer Kleber, der durch Wasser aufgelöst werden kann.
Genau Wasserschalter, komplett proteinbasiert.
Oh ja, ich merk’s.
Mit Peptiden hast du ja gesehen. Da können wir ein Aluminium beschichten. Aber wir können natürlich auch andere Metalle wie Titanlegierung für Medizinprodukte beschichten. Und die können wir uns jetzt gerne hier mal anschauen. Das sind dann bestimmte Coatings wie Kill und Repell, die dann sozusagen Entzündungen bei Implantaten verhindern. Aber wir müssen ja dann auch irgendwo testen, wie stabil bleibt so eine Beschichtung auf einer Oberfläche drauf.
Und hierbei wird getestet, ob das Material das aushält, die Reibung oder was? Genau.
Ob das Peptid nachdem es gebunden hat, wenn da mechanischer Stress drauf ist, Reibung, dass das auch wirklich fest an der Oberfläche unter möglichst Anwendungssbedingungen bindet.
Also damit wenn ich jetzt ein Implantat bekomme mit der Beschichtung, dass ich dann auch keine Probleme habe beim Zähneputzen.
Wenn man da schon ein bisschen drehen würde, reiben würde und dann wäre das drunter und dann ist die Beschichtung nicht gut.
Was im Labor funktioniert, muß sich am Ende auch im großen Maßstab bewähren. Dafür geht es weiter ins Manufacturing Technology Institut, kurz MTI. Hier wird unter anderem an modernen Verfahren geforscht, mit denen sich die biobasierten Beschichtungen nicht nur im Becherglas, sondern auch auf industriellem Niveau auftragen lassen. Das Ziel Verfahren zu entwickeln, die zuverlässig skalierbar und für unterschiedliche Branchen nutzbar sind, wie zum Beispiel die Anti Korrosion Beschichtung von Brennstoffzellen, wie es in dem Projekt von Professor Thomas Bergs gemacht wird, dem Leiter des Lehrstuhls für Fertigungstechnologien.
Okay, und hier wird also beschichtet.
Genau. Und das ist natürlich auch alles skalierbar und das ist das Ziel sozusagen skalierbare, kosteneffiziente Produktionsprozesse zu entwickeln. Und ein Anwendungsbeispiel Wir waren ja vorher beim Korrosionsschutz. Können wir auch das Geschichten von diesen Platten hier sein für eine Brennstoffzelle?
Die Verfahren, die im Kleinen erprobt wurden, lassen sich hier auf größere Maßstäbe übertragen und zeigen damit, wie aus Forschung Schritt für Schritt praxistauglich Anwendungen werden.
Schön, dass ja heute alle da warten und ich hoffe, ihr habt schöne Einblicke bekommen in die Biopharmaco Forschung.
Das ist wirklich beeindruckend, wie viel man mit Bio Funktionsbaustein heute schon machen kann.
Finde ich auch.
Vielen, vielen Dank und ich freue mich schon auf die nächste Innovation hier vom Lehrstuhl.
Super! Bis dann.
Tschüss