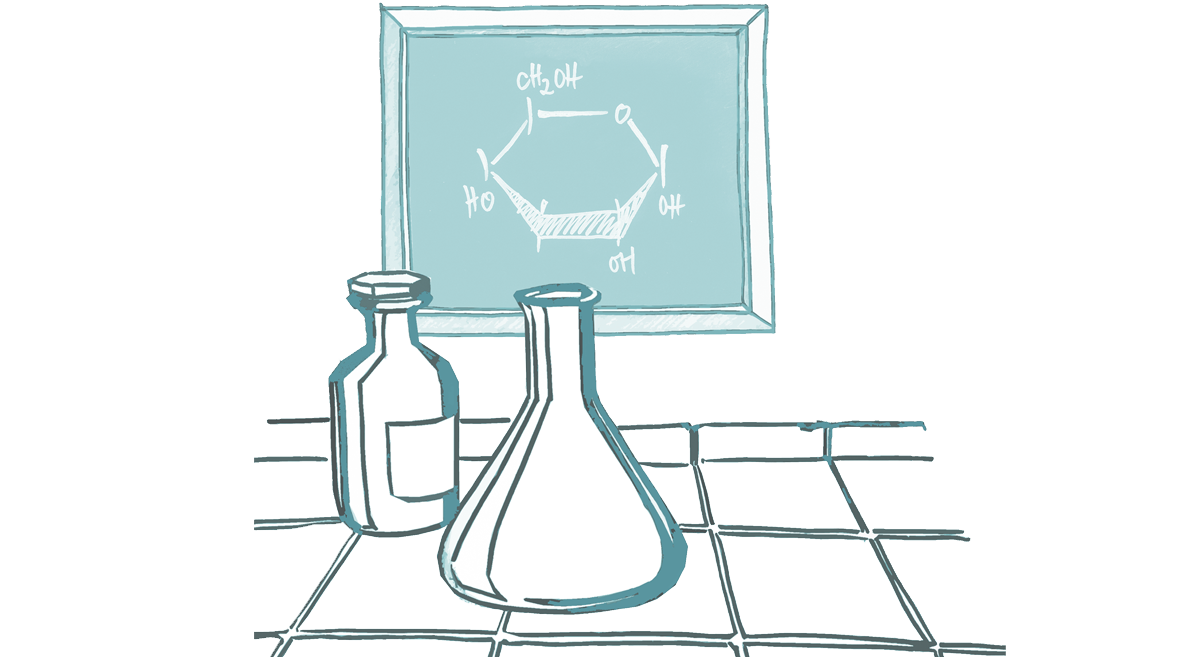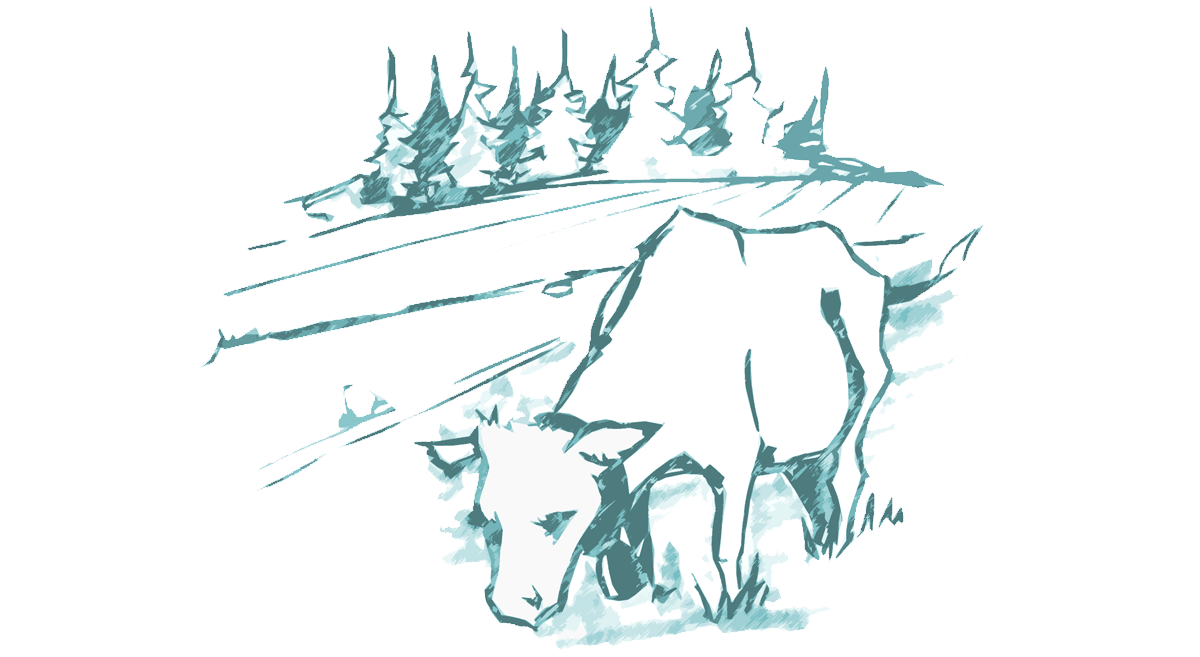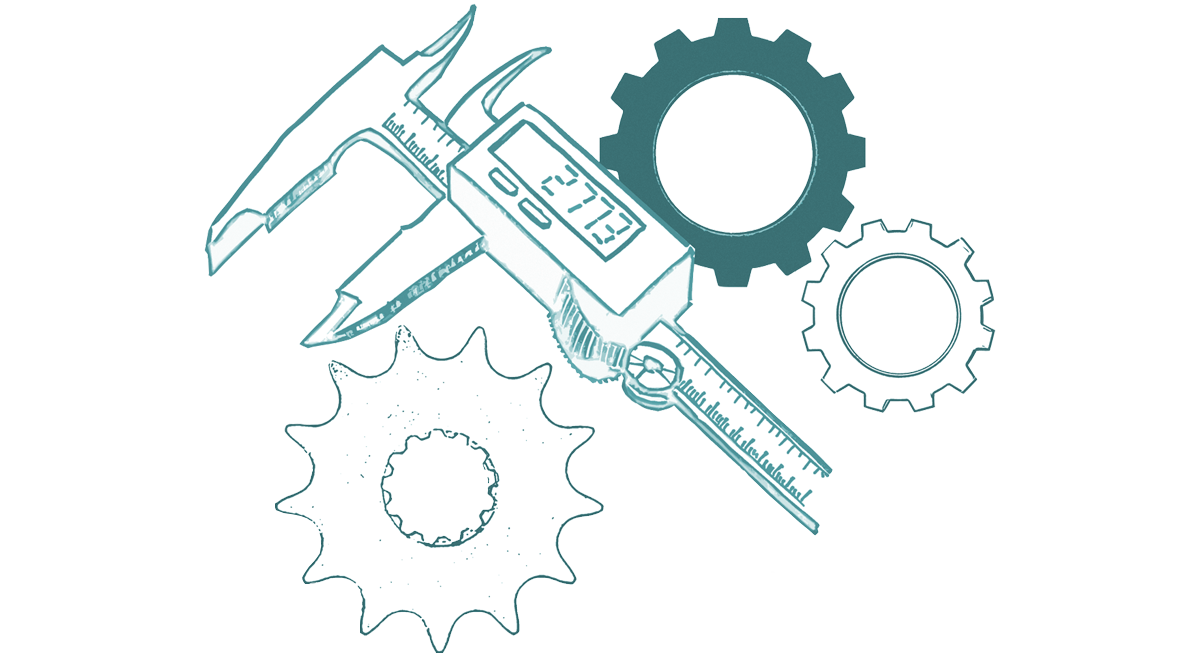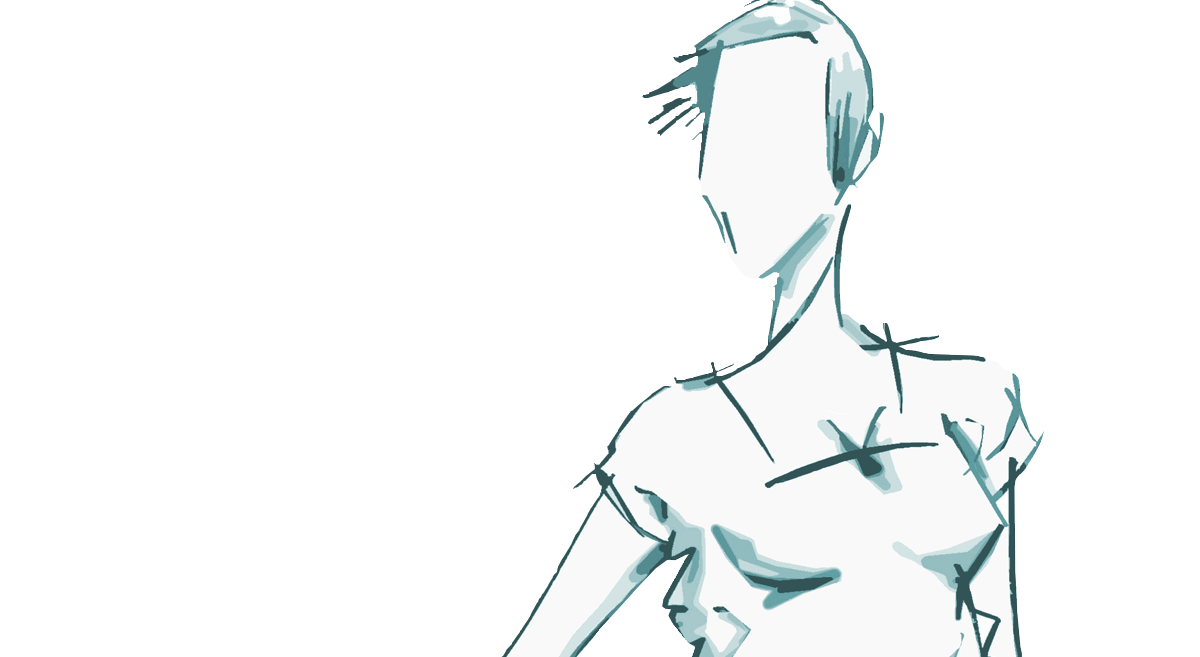Energie
Aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugte Bioenergie bleibt ein wichtiger Baustein im Energiemix der Zukunft. Mit Biogas-Anlagen werden landwirtschaftliche Betriebe zum Erzeuger von Strom und Wärme. Biokraftstoffe werden auch in einer elektromobilen Zukunft für den Schiffs- und Flugverkehr wichtig bleiben.
Beispiele aus der Bioökonomie:
Holzpelletheizungen,
Biogas, Biodiesel, Bioethanol,
synthetischer Biokraftstoff
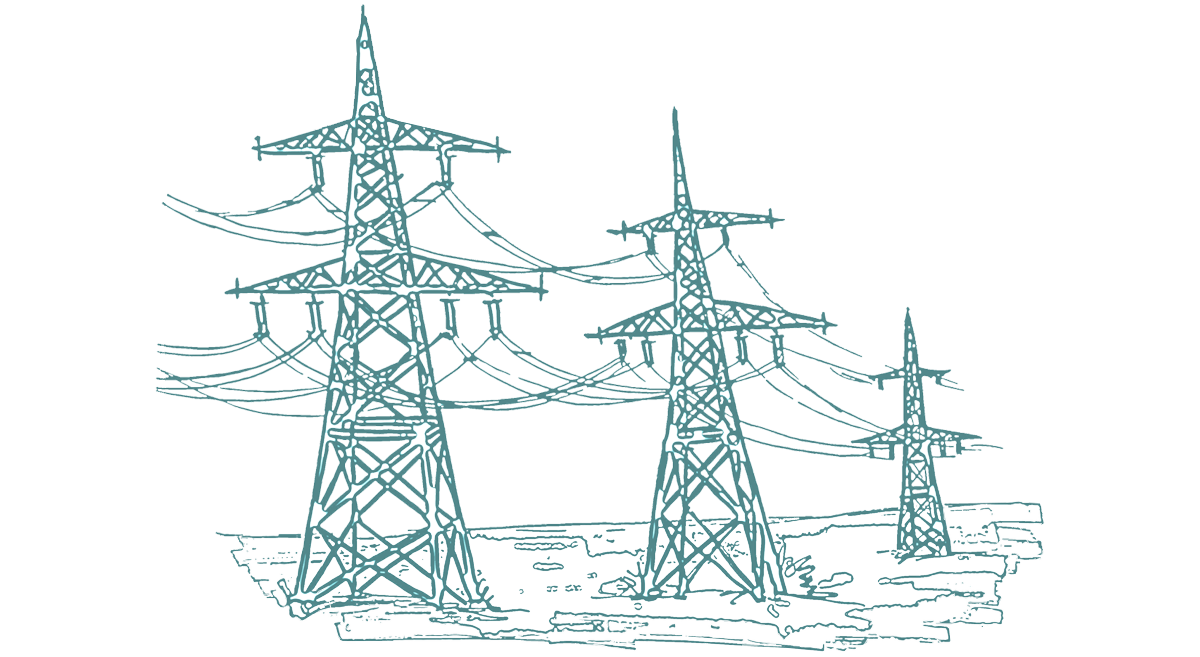
Mit der Energiewende will die Bundesregierung den Anteil der erneuerbaren Energiequellen deutlich steigern. Damit die Energieversorgung trotzdem zuverlässig, sicher und bezahlbar bleibt, hat die Bundesregierung den Energie- und Klimafonds (EKF) eingerichtet, um Projekte zu erneuerbaren Energien, zum nationalen und internationalen Klima- und Umweltschutz sowie zu Elektromobilität und Energieeffizienzinvestitionen (einschließlich Gebäudesanierung) zu fördern.
Bioenergie zählt als regenerative Energie zu den wichtigen Bausteinen im Energiemix der Zukunft. Biomasse – also Pflanzen sowie pflanzliche und tierische Reststoffe und Abfälle – gilt hierbei als Alleskönner. Denn sie lässt sich zur Erzeugung von Wärme, Strom und Kraftstoffen einsetzen. Neben der großen Vielfalt gilt als weiteres Plus: Biomasse ist speicherbar und Bioenergieanlagen sind flexibel regelbar. So bergen sie das Potenzial, bei der Stromerzeugung die schwankende Verfügbarkeit anderer regenerativer Energiequellen wie Windkraft und Solarenergie auszugleichen. Im Jahr 2024 stammte laut Umweltbundesamt der größte Teil (47 %) der in Deutschland eingesetzten erneuerbaren Energien aus Biomasse. Die bislang zur Verwertung von Biomasse eingesetzten Technologien erfüllen jedoch noch nicht alle Kriterien der Nachhaltigkeit und stehen deshalb in der Kritik. So kommen bei der Herstellung von Biokraftstoffen der ersten Generation wie Biodiesel oder Bioethanol ausschließlich die öl- und zuckerhaltigen Früchte von Kulturpflanzen zum Einsatz, die auch in der Nahrungsmittelindustrie genutzt werden. Damit ist eine Konkurrenz zwischen „Tank und Teller/Trog“ entstanden.
In Europa und Deutschland wurden die Nutzungspfade von Bioenergie in den vergangenen Jahren neu bewertet und die Rahmenbedingungen angepasst. Unter anderem in der Nationalen Bioökonomiestrategie betont die Bundesregierung, dass die Sicherung der globalen Ernährung stets Vorrang vor einer stofflichen und energetischen Nutzung hat. Die energetische Nutzung von Biomasse sollte sich künftig überwiegend auf organische Rest- und Abfallstoffe konzentrieren. Biokraftstoffe der zweiten Generation etwa werden aus nicht-essbaren Pflanzenteilen, also Reststoffen und verholzten Pflanzenteilen wie Stroh oder Holzhackschnitzel, hergestellt.
Der Rohstoff Holz hat eine große Bedeutung als Brennstoff. Im Jahr 2020 wurden in Deutschland rund 60 Mio. Kubikmeter Holz energetisch verwertet (ca. 50 % des gesamten Holzrohstoffaufkommens). Private Haushalte haben hierbei einen Anteil von 45,7 %. Etwas über die Hälfte des energetisch genutzten Holzes wird in Biomasseanlagen verfeuert. 27 % des energetisch genutzten Holzes entfällt auf Waldderbholz (dies ist überwiegend Laubholz und wird in privaten Haushalten verfeuert). 24,7 % entfallen auf Reststoffe aus der Holzverarbeitung und 22,5 % auf Altholz welches überwiegend in Großfeuerungsanlagen (> 1 MW) eingesetzt wird. Der Rest entfällt auf die übrigen Holzsortimente wie zum Beispiel Landschaftspflegeholz. Auf Basis von Biomasse werden etwa 90 % der erneuerbaren Wärme erzeugt. Die moderne und vollautomatische Technologie der Pelletheizungen ermöglicht es, den Ausstoß von Luftschadstoffen wie Feinstaub und Kohlenmonoxid deutlich zu reduzieren. Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) stellt auf ihrer Webseite umfassende Informationen zum Thema Heizen mit Holz zur Verfügung
(heizen.fnr.de).
In Biogas-Anlagen werden Pflanzen, tierische Exkremente wie Gülle und andere Reststoffe in Biogas verwandelt. In luftdicht abgeschlossenen Behältern, den Fermentern, vergären Mikroorganismen die Biomasse zu einem Gasgemisch, das hauptsächlich aus Methan und CO2 besteht. Vor Ort wird das Biogas in Gasmotoren zur Strom- und Wärmeerzeugung verbrannt. Nach dem Vergären bleibt organisches Material übrig, das als Dünger auf den Acker ausgebracht werden kann. In einigen Anlagen wird Biogas auch zu Biomethan aufbereitet. Hierzu werden der Methangehalt und die Qualität des Biogases soweit gesteigert, dass es ins Erdgasnetz eingespeist werden kann.
Ende 2023 waren in Deutschland knapp 10.000 Biogasanlagen in Betrieb, die mehr als 5.900 Megawatt Strom erzeugten. Bei der Verfahrens- und Prozesstechnik in Biogasanlagen gibt es noch viel Potenzial für Verbesserungen. Das BMEL fördert mit dem Projekt NextGenBiogas die Entwicklung einer neuen Generation von flexibilisierten Biogasanlagen (vgl. Maschinenbau). Zentral für den Betrieb sind auch die eingesetzten Energiepflanzen. Überwiegend wird heute Maissilage eingesetzt. Mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) von 2021 hat die Bundesregierung beschlossen, den Substrat-Anteil von Mais und Getreidekorn auf 40 % abzusenken. Zunehmend geraten mehrjährige Gewächse wie das anspruchslose Gras Miscanthus oder die Durchwachsene Silphie in den Blick. Das Berliner Start-up SOLAGA setzt hingegen auf Mikroalgenfilme, um Biogas in kleinen Anlagen zu gewinnen, die in privaten Haushalten aufgestellt werden können.

Mit Blick auf Klimaneutralität und dem Umstieg auf Strom und Wasserstoff als Energieträger bleiben Flüssigtreibstoffe auch in Zukunft wichtig, etwa für den Schwerlast- und den Schiffsverkehr. Biodiesel wird aus pflanzlichen Ölen oder tierischen Fetten hergestellt. In Europa wird der größte Anteil des Biodiesels aus Rapsölen gewonnen. Raps eignet sich für die Herstellung von Biodiesel, da der Fettgehalt in den Samen bis zu 45 % beträgt. Auch Biodiesel aus Reststoffen gewinnt zunehmend an Bedeutung, etwa aus altem Speiseöl und Frittierfett. In Deutschland wurden nach Angaben der FNR im Jahr 2020 etwa 3 Mio. Tonnen Biodiesel aus Pflanzenölen und gebrauchten Speiseölen verbraucht.
Biokraftstoffe der nächsten Generation
Biomasse aus agrarischen Reststoffen wie beispielsweise Getreide- und Maisstroh, Miscanthus oder Holz steht neben Biogas auch für andere Formen der bioenergetischen Nutzung hoch im Kurs. Die effiziente und möglichst vollständige Nutzung von Pflanzenresten, Stroh oder Holz wird durch die in Zellwänden enthaltene Substanz Lignocellulose erschwert. Es gibt verschiedene Ansätze, um die Lignocellulose aufzuschließen. Im bayerischen Straubing betreibt der Chemiekonzern Clariant eine Bioraffinerie-Demonstrationsanlage, in der Stroh in seine Bestandteile zerlegt und dann biotechnisch in Cellulose-Ethanol umgewandelt wird. Das mithilfe des „sunliquid“-Verfahrens gewonnene Bioethanol kann dann Benzin für Otto-Motoren beigemischt werden. Ende 2021 wurde mit EU-Förderung der Bau einer kommerziellen Bioraffinerie-Anlage in Rumänien abgeschlossen.
Eine Herausforderung bei der Bioethanol-Herstellung ist, dass der lösliche Alkohol zumeist noch vom Wasser energetisch aufwendig abgetrennt werden muss. Neue Forschungsansätze zielen daher darauf ab, die Lignocellulose in einen Biosprit umzuwandeln, der nur schwer in Wasser löslich ist. Zu den Alternativen gehört der langkettige Alkohol Butanol, der aufgrund anderer physikalischer und chemischer Eigenschaften nicht nur wasserunlöslich ist, sondern auch eine höhere Kraftstoffeffizienz als Ethanol bietet. Derzeit wird an Verfahren gearbeitet, Butanol aus ganzen Pflanzen oder Pflanzenresten zu gewinnen. Das französische Unternehmen Global Bioenergies hat ein biotechnisches Verfahren entwickelt, in dem Bakterien den gasförmigen Kohlenwasserstoff Isobuten herstellen. Global Bioenergies stellt das Isobuten an seinem Standort in Leuna her. Es lässt sich in Isooktan umwandeln. Der Autohersteller Audi testet den biobasierten Treibstoff im Rahmen einer Kooperation auf Alltagstauglichkeit.
Für die Gewinnung von Biotreibstoffen rücken zunehmend auch Mikroalgen und Cyanobakterien in den Fokus. Diese Mikroorganismen betreiben Photosynthese und können somit direkt die Energie des Sonnenlichts für die Herstellung von energiereichen Zuckermolekülen aus CO2 nutzen. In einem weiteren Schritt können die Zucker dann durch den Mikrobenstoffwechsel zu Lipiden und Ölen umgewandelt werden, die wiederum zu Kraftstoffen verarbeitet werden. Kraftstoffe, die aus photosynthetischen Organismen und CO2 als Kohlenstoffquelle gewonnen werden, bezeichnen Fachleute auch als Biokraftstoffe der dritten Generation. Mit dem Algentechnikum der Technischen Universität München wurde auf dem Bölkow-Campus ein hochmodernes Algenforschungslabor errichtet. Hier werden seit 2016 größtenteils Algen mariner Herkunft auf ihre Fähigkeit untersucht, bei extremen Salzkonzentrationen fette Öle herzustellen, die sich für die Herstellung von Flugzeugtreibstoffen und anderen Industriechemikalien eignen. Der Bau des Algentechnikums wurde aus Landesmitteln und von der Airbus Group finanziert. Am Forschungszentrum Jülich wird in einem „Algen Science Center“ ebenfalls an nachhaltigem Kerosin aus Algenöl geforscht.

Synthetische Biokraftstoffe
Ein thermochemisches Konzept steht hinter den Biomass-to-Liquid (BtL)-Treibstoffen: Hier werden die komplexen Moleküle der Biomasse bei hoher Temperatur in ein Synthesegas (Kohlenmonoxid und Wasserstoff) umgewandelt. Mithilfe der seit Jahrzehnten bekannten Fischer-Tropsch-Synthese wird das Synthesegas dann zu flüssigen Kohlenwasserstoffen – dem gewünschten Kraftstoff – umgewandelt. Die in der Biomasse ebenfalls enthaltenen Elemente wie Stickstoff oder Schwefel werden abgetrennt. Der synthetische Treibstoff ist frei von Fremdstoffen und hat deshalb dieselben Verbrennungseigenschaften wie etwa herkömmlicher Diesel. Ein weiterer Vorteil: Potenziell kann die gesamte Pflanze genutzt werden. Deshalb eignen sich Stroh oder Holzhackschnitzel für die Verwertung zu BtL-Krafstoffen. Eine kommerzielle Nutzung der Technik erfolgt noch nicht. Es wird jedoch intensiv an BtL-Kraftstoffen geforscht. Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wird in einer Pilotanlage das „bioliq“-Verfahren zur Herstellung von Synthesekraftstoffen entwickelt.
Wasserstoff gilt als Energieträger der Zukunft, da er CO2-arm erzeugt und genutzt werden kann. Bislang jedoch wird Grüner Wasserstoff vor allem chemisch mittels Wasser-Elektrolyse produziert, ein Prozess der viel Strom aus regenerativen Quellen verbraucht. Es gibt aber auch einige biobasierte Wege zum Grünen Wasserstoff. Einer davon ist die Photosynthese von Grünalgen oder Bakterien: mithilfe von Lichtenergie und katalysiert durch Enzyme werden in der Lichtreaktion Wassermoleküle in Sauerstoff, Protonen (also Wasserstoff-Ionen) und Elektronen zerlegt. Bestimmte Enzyme – die Hydrogenasen – helfen anschließend dabei, molekularen Wasserstoff herzustellen. Ein Kasseler Forschungsteam hat zum Beispiel Cyanobakterien mithilfe molekularer Werkzeuge zu biologischen Wasserstofffabriken umfunktioniert. Auch in Biogasanlagen können Mikroorganismen unter speziellen Bedingungen Biomasse in die Gase Wasserstoff und CO2 umwandeln (Dunkelfermentation). An beiden Wegen zum Biowasserstoff wird intensiv geforscht.
Bislang enthalten fast alle Batterien Metallverbindungen, basierend auf Lithium, Blei oder Vanadium, deren Gewinnung und Recycling aufwändig und oft mit Umweltproblemen verbunden sind. Die Entwicklung einer pflanzenbasierte Alternative wird derzeit vom BMEL gefördert. Dabei geht es um stationäre Redox-Flow-Batterien, die Energie in großtechnischen Maßstab speichern können. Der benötigte Elektrolyt soll zukünftig aus dem Holzbestandteil Lignin gewonnen werden. Auch Biogasanlagen lassen sich heute als chemischer Energieträger und -speicher im Stromsektor flexibel einsetzen. In einem vom BMEL geförderten Projekt wird nach Möglichkeiten gesucht, Biogasanlagen mit Batteriespeichern zu kombinieren, um neue Vermarktungswege zu eröffnen.