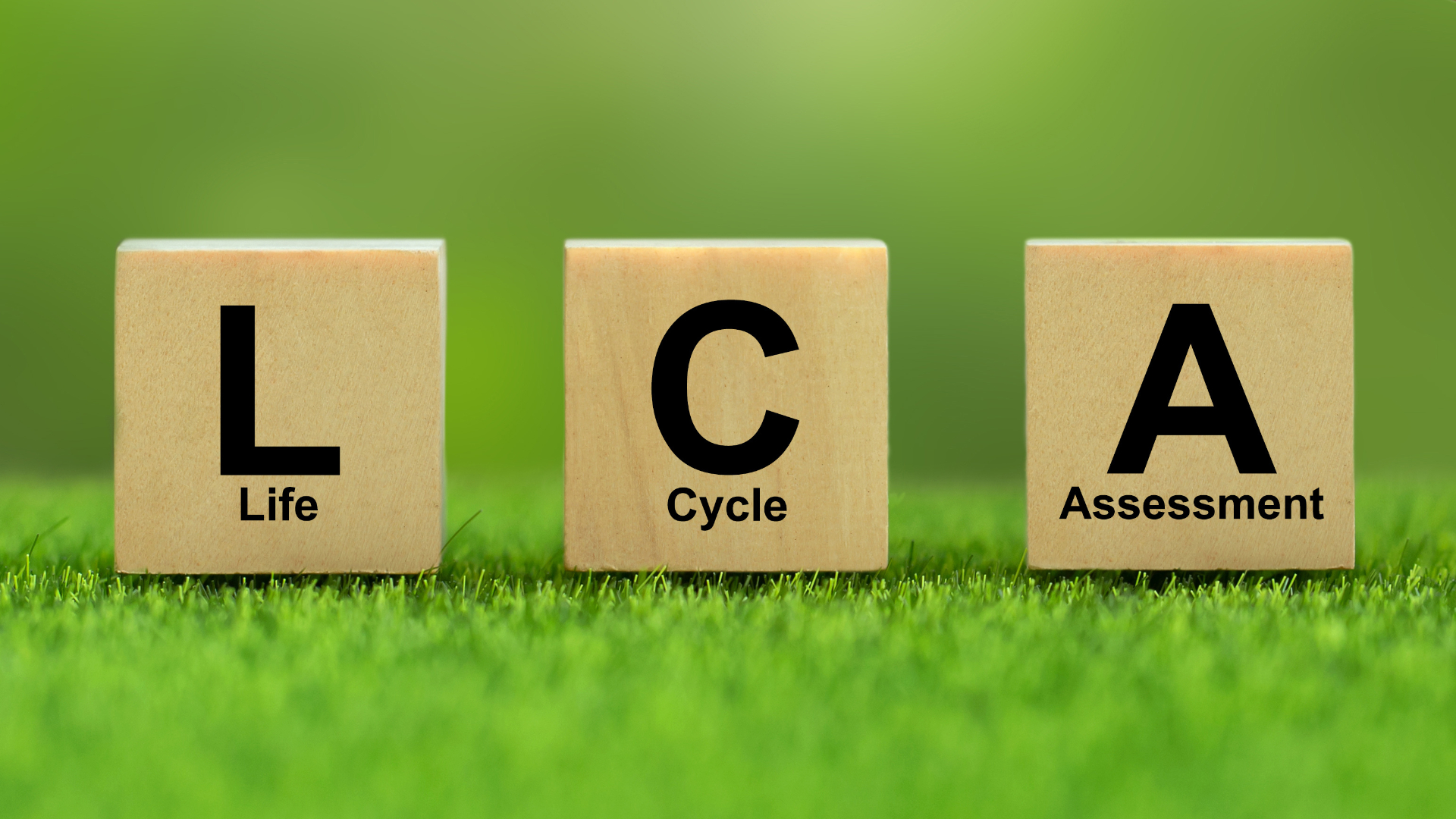Strategie
Bei der National Bioeconomy Strategy (NBS) stehen die Land- und Gesundheitswirtschaft sowie die industrielle Biotechnologie im Mittelpunkt. Die Strategie zielt auf ein Wachstum der biobasierten Wirtschaft durch die Nutzung biologischer Ressourcen, den Ausbau von Forschung und die Kommerzialisierung biobasierter Innovationen ab. Diese Schwerpunktsetzung bleibt beim Decadal Plan (Umsetzung des White Paper on Science, Technology and Innovation, 2019) bestehen, die Bioökonomie ist jedoch in einen breiteren innovationspolitischen Kontext eingebunden: Es wird das übergeordnete Ziel verfolgt, Wissenschaft und Innovation systemisch in die Bereiche Wirtschaftswachstum, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit einzubinden. Die Bioökonomie gilt dabei als eines von vier prioritären Feldern sowie als Schlüsselsektor für die wertschöpfende Nutzung der nationalen Biodiversität, die Förderung der grünen Industrie, die Ernährungssicherung sowie die Entwicklung biobasierter Gesundheits- und Agrarlösungen. Der Plan strebt außerdem den Aufbau regionaler Innovationsökosysteme, verstärkte öffentliche und private Investitionen sowie die Kommerzialisierung biotechnologischer Forschung an. Im Unterschied zur NBS wird die Bioökonomie dabei stärker als Bestandteil eines vernetzten Innovationssystems verstanden, das auf die langfristige Transformation in Richtung einer nachhaltigen, wissensbasierten Wirtschaft ausgerichtet ist.
Akteure und Förderung
Herausgeber dieser drei Dokumente ist das Department of Science, Technology and Innovation (DSTI), welches die zentrale staatliche Instanz für die Steuerung und Förderung der südafrikanischen Bioökonomie ist. Neben der Entwicklung strategischer Fahrpläne stellt die Institution gezielt Fördermittel zur Verfügung, um Forschung und Entwicklung (F&E) im biobasierten Sektor voranzutreiben. Die Ausführung erfolgt über nachgeordnete Institutionen wie die Technology Innovation Agency (TIA), die etwa für das Agricultural Bioeconomy Innovation Partnership Programme (ABIPP) zuständig ist. Neben der Kommerzialisierung agrarbiotechnologischer Innovationen konzentriert man sich dabei auf Kooperationen von Wissenschaft, Industrie und Politik sowie die Unterstützung ländlicher Agrarstrukturen. Der Schwerpunkt der Agrarförderung ist jedoch im Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development (DALRRD) angesiedelt. Mit dem Comprehensive Agricultural Support Programme (CASP) hat man beispielsweise vor allem Kleinbauern und deren Anbau von Nahrungsmittelpflanzen im Blick. Zudem investiert das Ministerium in so genannte Agri-Park-Modelle: kommunale Netzwerke für die Erzeugung, Weiterverarbeitung, Logistik und Vermarktung von Lebensmitteln sowie für Schulungs- und Beratungsleistungen. Während außerdem das Department of Trade, Industry and Competition (DTIC) Förderinstrumente für biobasierte Produkte im Rahmen des Industrial Policy Action Plan anwendet, verantwortet das Umweltministerium Gelder, die für das Bioprospecting und die nachhaltige Nutzung genetischer Ressourcen – etwa im Bereich Heilpflanzen – zum Einsatz kommen.
Südafrika verfügt über eine vielfältige und in großen Teilen international angesehene Wissenschaftslandschaft, die im Bioökonomiebereich von mehreren Forschungseinrichtungen und spezialisierten Programmen geprägt ist.
Zu den führenden Institutionen zählen das Forestry and Agricultural Biotechnology Institute (FABI) und der National Biosecurity Hub, beide von der University of Pretoria. Letzterer wurde zur Implementierung der Bioökonomiestrategie von DSTI und DALRRD eingesetzt, um die Forschung und Koordination zur Vorbeugung und Kontrolle von Pflanzen- und Tierkrankheiten, die Lebensmittelsicherheit und den Agrarhandel zu stärken. Das FABI fokussiert biotechnologische Lösungen für die Pflanzen- und Forstwirtschaft, etwa resistentere Mais- und Weizensorten, und setzt grundsätzlich auf enge Industriekooperationen. Mit dem Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) ist im Land zudem Afrikas größte F&E-Organisation angesiedelt. Teil derer ist das Biomanufacturing Industry Development Centre (BIDC), das als zentrales Innovationszentrum für KMU in der Bioökonomie gilt. Es unterstützt die Entwicklung und Kommerzialisierung biobasierter Produkte aus Bereichen wie Gesundheit, Landwirtschaft und Umwelt mit einer modernen Infrastruktur – von voll ausgestatteten Laboren bis zu großen Fermentationsanlagen.
Studienangebote im Bereich Bioökonomie und Biotechnologie existieren an mehreren Hochschulen, beispielsweise in Form von Bachelor- und Masterprogrammen in Industrial Biotechnology, Agricultural Biotechnology oder Bioeconomy Management, besonders an den Universitäten Stellenbosch, Pretoria und Western Cape. Nachwuchskräfte können auf verschiedene staatliche Stipendien- und Postgraduierten-Programme zurückgreifen.
Die Bioökonomie spielt in Südafrika eine bedeutende Rolle und trug nach Schätzungen des Malabo Montpellier Panels in den Jahren 2007 bis 2020 jeweils rund 8 % zum BIP bei. Der größte Anteil ist in den Sektoren Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung, Forstwirtschaft, Biotechnologie und erneuerbare Energien zu verzeichnen.
In der Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung liegt der Fokus auf der Produktion von Nahrungs- und Futtermitteln, während die Forstwirtschaft mit der Holz- und Papierindustrie eine wichtige wirtschaftliche Säule bildet. Die Biotechnologie bringt die Entwicklung neuer Produkte und Verfahren, etwa in der Medizin und Agrarwirtschaft voran. Im Bereich erneuerbare Energien wächst die Nutzung von Biomasse, insbesondere für die Herstellung von Biokraftstoffen wie Ethanol und Biodiesel aus landwirtschaftlichen Abfällen. Darüber hinaus werden biobasierte Kunststoffe und Biopharmazeutika produziert.
Global agierende Unternehmen wie Sasol, das in der Entwicklung von Biokraftstoffen aktiv ist, Nampak als Hersteller biobasierter Verpackungen und Aspen Pharmacare im Bereich Biopharmazeutika leisten einen wichtigen Beitrag zur Transformation von Südafrikas Wirtschaft und treiben deren sektorübergreifende Entwicklung maßgeblich voran. Die Vernetzung von Bioökonomie-Stakeholdern findet zudem in Zusammenschlüssen wie der South African BioEnergy Association (SABEIA) statt.
Autorin: Kristin Kambach