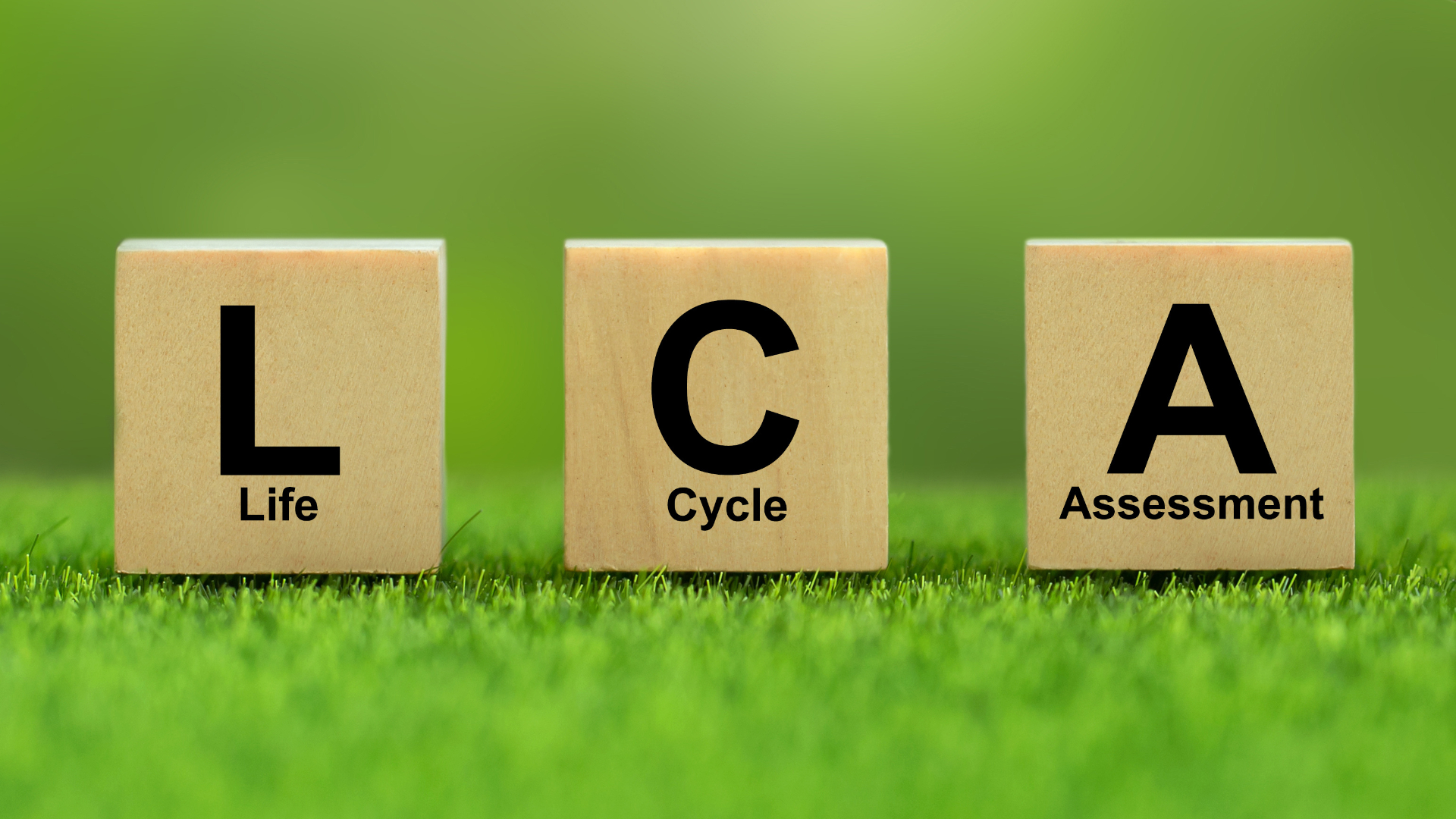Wie der Bioökonomiestrategie des Landes Familiar resources – undreamt of possibilities (ENG-Kurzfassung) von 2016 zu entnehmen ist, handelt es sich dabei vor allem um die Bereiche Forst- und Landwirtschaft, Fischerei sowie Aquakultur. Ziel des federführenden Wirtschafts-, Industrie- und Fischereiministeriums ist die gezielte Förderung von Innovationen in diesen Sektoren, um neben neuen Produkten ganzheitliche Kreislaufkonzepte zu entwickeln. Als zusätzliche Prioritäten sind die Unterstützung von Wissen und Forschung zur Bioökonomie sowie internationale und sektorübergreifende, integrative Kooperationen genannt.
Letztere spielen auch eine wichtige Rolle in der norwegischen Förderlandschaft: Gemeinsam mit dem norwegischen Forschungsrat (RCN) als politischem Beratungsorgan sowie den nachgelagerten Behörden Innovation Norway und The Industrial Development Corporation of Norway (SIVA) koordiniert das Wirtschaftsministerium Programme wie die Green Platform Initiative, die seit 2020 Unternehmen und Forschungseinrichtungen bei der Entwicklung biobasierter Produkte und Dienstleistungen unterstützt.
Neben dem Wirtschaftsministerium wird diese Ausrichtung von weiteren Ressorts wie Umwelt, Landwirtschaft und Energie verfolgt, mit zusätzlichen Elementen in dem Whitepaper Norway’s Climate Action Plan for 2021–2030 ergänzt und zum Teil konkretisiert. Bei dem Dokument handelt es sich um eine umfassende Klimaschutzstrategie einschließlich sektorübergreifenden Maßnahmen und spezifischen Instrumenten wie der Förderung von Biogas. Beabsichtig ist, für dessen Erzeugung verstärkt auf organische Reststoffe wie Gülle und Lebensmittelabfälle zurückzugreifen und Biomethan vermehrt in Industrie und Schwerlastlogistik einzusetzen. Passende Fördermaßnahmen umfassen Investitionshilfen, Forschungsförderung und regulatorische Anreize.
Mit The Green Industrial Initiative hat die norwegische Regierung im Jahr 2022 einen weiteren politischen Fahrplan veröffentlicht, der die Bioökonomie als Schlüsselbereich für Norwegens grüne Transformation abermals betont. Besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung nachhaltiger Wertschöpfungsketten, um Arbeitsplätze zu schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit Norwegens im internationalen Kontext zu stärken.
Bioökonomie in den Regionen
Die nationalen Fahrpläne zur Bioökonomie werden in Norwegen durch mehrere regionale Strategien und horizontale Zusammenschlüsse ergänzt. Dokumente wie Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017–2024 fokussieren standortspezifische Stärken und Wertschöpfungsketten. In diesem Fall steht die Nutzung von Holz und Reststoffen aus der Landwirtschaft und der Lebensmittelverarbeitung im Mittelpunkt. In Rogaland wurde die Strategi for bioøkonomi i Rogaland 2018–2030 verabschiedet, die die Bioökonomie mit dem regional starken Agrar- und Aquakultursektor verknüpft und darin eine Chance für eine innovative Kreislaufwirtschaft und die technologische Aufwertung organischer Nebenprodukte sieht.
Norwegens Wissenschaftssystem gilt als hochqualitativ, international stark vernetzt und anwendungsorientiert – dies trifft auch auf den Bioökonomiebereich zu. Außerdem existieren vielerorts enge Verbindungen zu Politik, Wirtschaft und Industrie. Transdisziplinäre Forschungszentren und Cluster wie das Norwegian Centre for Sustainable Bio-based Fuels and Energy (Bio4Fuels) sind Ausdruck dessen. Grundsätzlich profitiert die Forschungslandschaft in hohem Maße von der Arbeit des RCN, der gezielt Projekte zur biobasierten Transformation unterstützt.
An mehreren Instituten sind Schwerpunkte zur Biotechnologie, Kreislaufwirtschaft, nachhaltigen Ressourcennutzung und industriellen Bioökonomie zu finden. Von besonderer Bedeutung ist das Norwegische Institut für Bioökonomie (NIBIO), das anwendungsorientierte Forschung entlang der gesamten Bioressourcenkette – von Land- und Forstwirtschaft über Bodennutzung bis hin zur Verarbeitung biologischer Rohstoffe – betreibt. Auch SINTEF in Trondheim, eines der größten unabhängigen Forschungsinstitute Europas, hat mehrere Programme zu zirkulärer Bioökonomie, innovativen marinen Ressourcen und Bioenergie.
Wichtige universitäre Standorte sind darüber hinaus die Norwegian University of Life Sciences (NMBU), die Studiengänge wie Agroecology, Urban Agriculture und Aquatic Food Production anbietet. Die NTNU (Norwegian University of Science and Technology) kann mit hoher Kompetenz in den Bereichen Bioenergie und industriellen Ökosysteme aufwarten. Die Arctic University of Norway (UiT) und die in Bergen (UiB) verfügen über spezialisierte Studienangebote zu mariner Biotechnologie und nachhaltiger Ressourcennutzung im arktischen Raum.
Die internationale Ausrichtung der norwegischen Bioökonomieforschung wird etwa durch die BMFTR-Initiative Bioeconomy in the North (BiN) deutlich. Deutschland und Norwegen sind zwei von fünf Partnerländern, die in diesem Rahmen das gemeinsame Ziel verfolgen, Forschung und Innovation durch die Förderung internationaler Verbundvorhaben zu unterstützen, insbesondere zu neuen Produkten und Dienstleistungen aus Non-Food-/Non-Feed-Biomasseressourcen.
Die Bioökonomie spielt in Norwegens Wirtschaft, vor allem seit Veröffentlichung der Strategie im Jahr 2016, eine zunehmend bedeutende Rolle. Steigende Investitionen in industrielle Bioraffinerien, höhere Forschungsausgaben, wachsende Exportzahlen biobasierter Produkte (z. B. Algen, Biopolymere) sowie eine Zunahme regionaler Innovationscluster bilden dies ab. Die Erfolge basieren in erster Linie auf der innovativen Nutzung biologischer Ressourcen aus Land- und Meeresgebieten.
Zentrale Sektoren sind die Forst- und Landwirtschaft, Fischerei, Aquakultur sowie die industrielle Biotechnologie. Es gibt immer mehr Unternehmen, die Pilotanlagen gegen fortschrittliche Bioraffinerien tauschen und damit beispielsweise Holz in Bioethanol, Vanillin und andere biobasierte Produkte umwandeln. Andere Firmen sind weltweit führend in der Gewinnung von Krill- und Algenöl für Nahrungsergänzungsmittel und Tierfutter. Weitere sind auf die Enzymproduktion für verschiedene industrielle Anwendungen oder auf die technologische Umwandlung von Bioabfällen in Biogas und Dünger spezialisiert.
Unterstützung erfährt diese Dynamik durch mehrere Clusterinitiativen und Wirtschaftsverbände. Einer der wichtigsten Zusammenschlüsse ist der NCE Heidner Biocluster, dessen Mitglieder die gesamte Wertschöpfungskette von Züchtung und Biotechnologie über Futtermittelentwicklung bis hin zur Verwertung von Nebenströmen abdeckt. Weitere wichtige Cluster sind Biotech North mit Fokus auf marine Biotechnologie und Arena SKOG, der die Forst- und Holzindustrie stärkt.
Autorin: Kristin Kambach