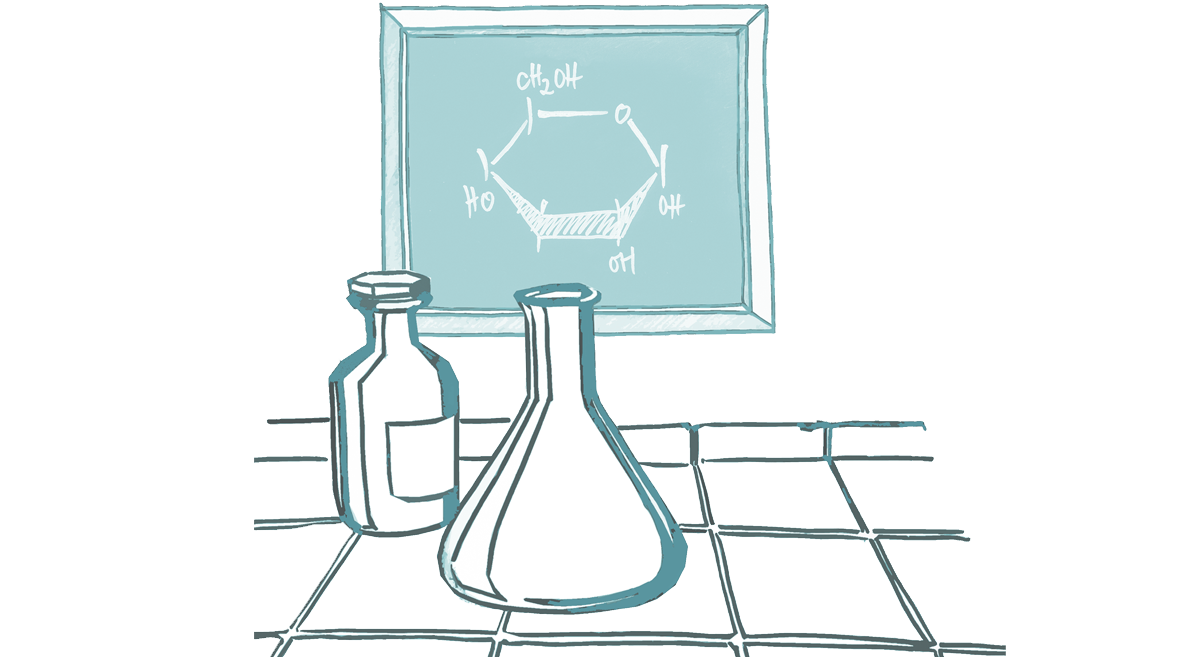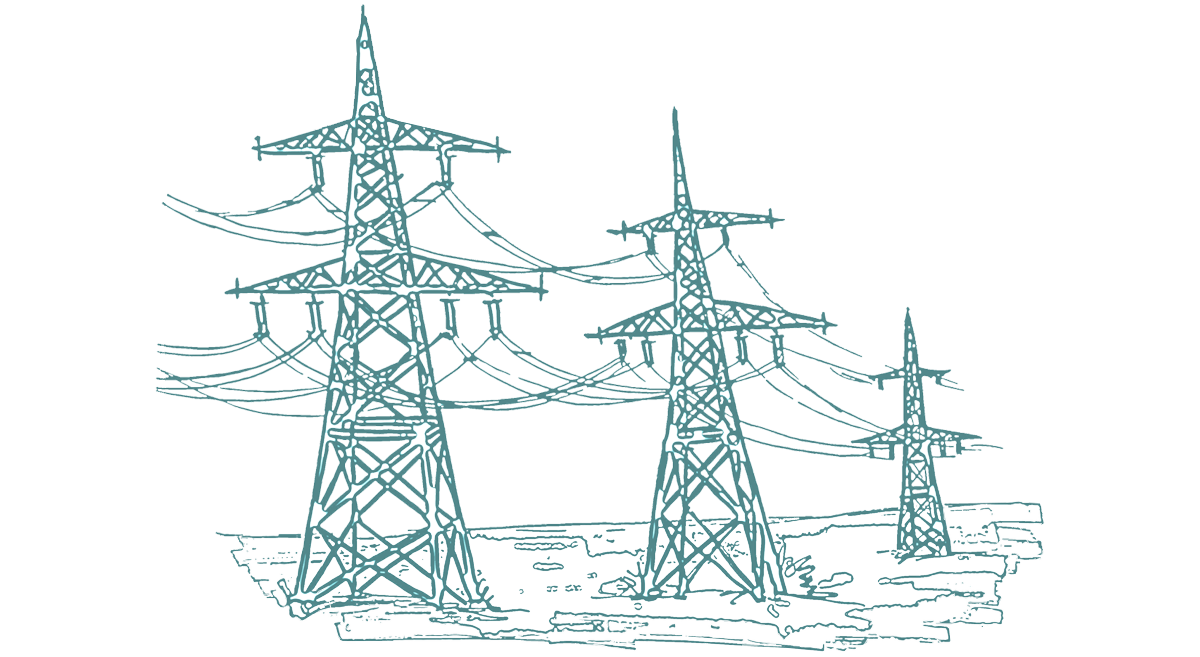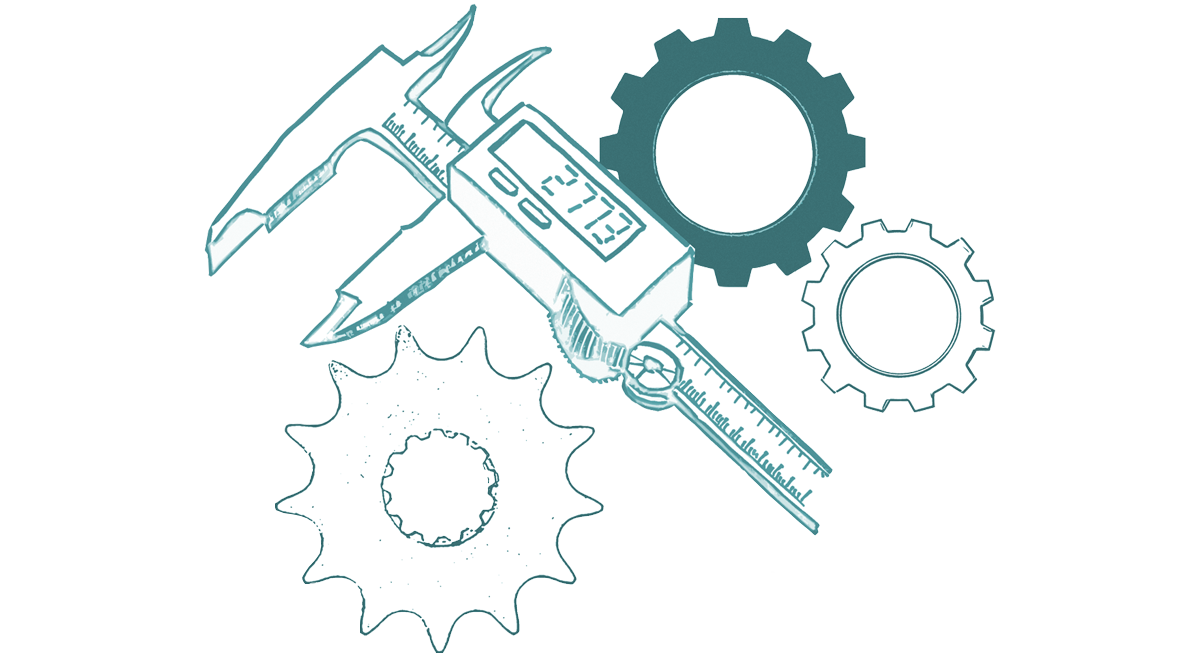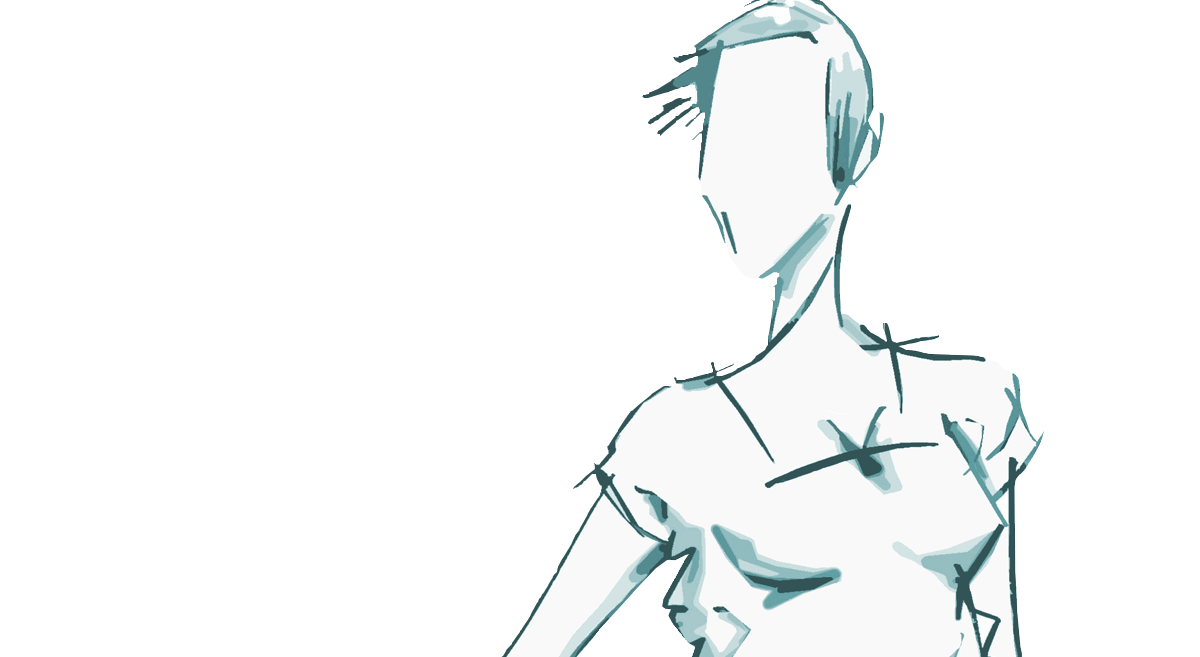Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft sind tragende Säulen der Bioökonomie. Die auf Wiesen, Äckern und in Wäldern erzeugte pflanzliche Biomasse bildet eines der Fundamente für die biobasierte Wirtschaft. Moderne Anbautechnologien erlauben es, nachhaltiger und ressourceneffizienter zu produzieren.
Produkte aus der Bioökonomie:
Biobasierte Rohstoffe, Aquakultur,
Agrarholz, Pflanzen- und Tierzucht
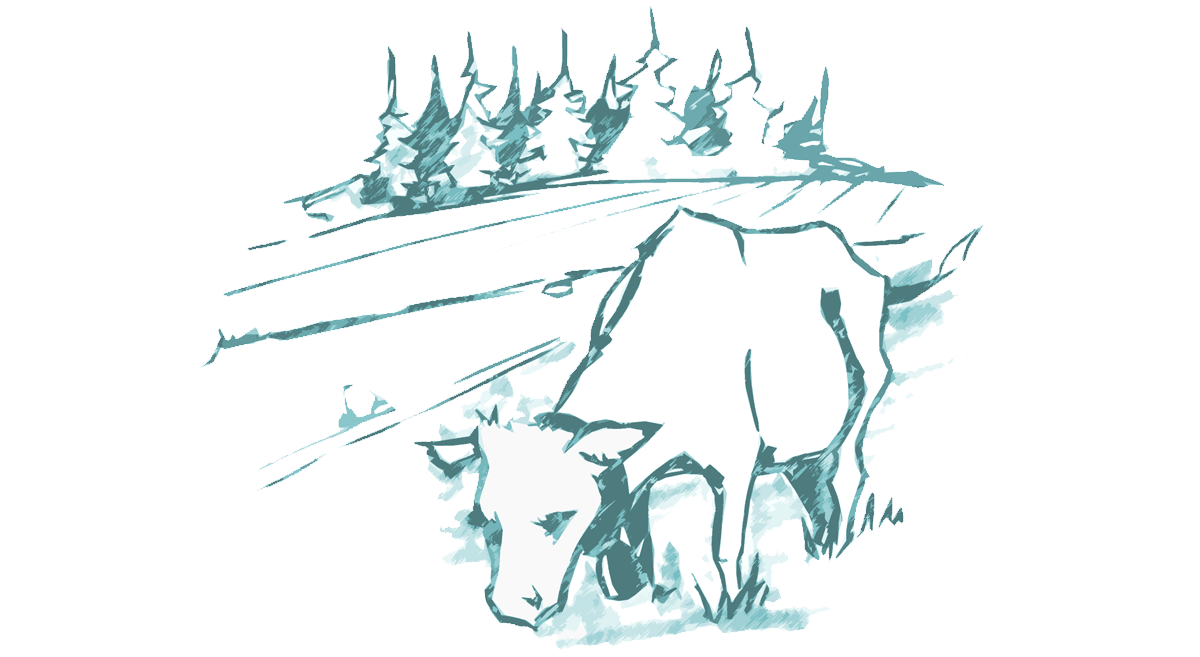
Land- und Forstwirtschaft stellen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor dar. Knapp 263.000 landwirtschaftliche Betriebe und rund 29.000 forstwirtschaftliche Betriebe waren laut BMEL im Jahr 2020 in Deutschland aktiv. Die Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft für die Wertschöpfung im ländlichen Raum ist groß. Land- und Forstwirtinnen und -wirte bewirtschaften und pflegen mehr als Dreiviertel der Fläche Deutschlands. Neben dem vorrangigen Anbau von Nahrungs- und Futtermitteln erzeugen sie auch biobasierte Rohstoffe für die Industrie und Biomasse für erneuerbare Energien. Dazu gehören Holz, Industrie- und Energiepflanzen wie Raps, Mais oder Miscanthus sowie Nebenprodukte wie Gülle oder Stroh. In Fermentern entstehen aus der landwirtschaftlichen Biomasse Ausgangsstoffe für biobasierte Kunststoffe oder andere nachhaltige Chemikalien (vgl. Chemie), in Biogasanlagen oder Blockheizkraftwerken werden daraus Wärme, Strom und Kraftstoffe (vgl. Energie). Holz aus der Forstwirtschaft ist eine bedeutende und vielseitige Ressource für die Bioökonomie: Es kann etwa zu Schnitt- und Sperrholz, zu Holzwerkstoffen und Holz-Kunststoff-Verbünden, zu Zellstoffprodukten wie Papier und Pappe, zu Pellets und Briketts und vielen weiteren innovativen Produkten verarbeitet werden.
Rund die Hälfte der Fläche Deutschlands wird landwirtschaftlich genutzt. Von insgesamt rund 16,6 Mio. Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche entfallen laut BMEL rund 70 % auf Ackerland. Weitere 29 % werden als Grünland genutzt und nur 1 % für Dauerkulturen wie Obst- und Weinbau. Auf mehr als der Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland werden Futtermittel, auf rund einem Viertel der Fläche Kulturpflanzen angebaut, die direkt der Ernährung dienen. Die restliche Fläche wird für die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen für Energie und industrielle Verwertung genutzt.
Ackerbauliche Produktionssysteme sind Grundpfeiler der Ernährung. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Weltbevölkerung bei gleichzeitig begrenzt verfügbaren Ackerflächen, dem Klimawandel oder der Notwendigkeit der Bewahrung schützenswerter artenreicher Naturräume muss der Ackerbau in Deutschland stärker auf Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit ausgerichtet werden. Die „Ackerbaustrategie 2035“ benennt daher zentrale Handlungsfelder für den Ackerbau der Zukunft und den Beitrag der Landwirtschaft zu Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz.

Die Bioökonomie-Forschung für die Landwirtschaft verfolgt mehrere Ziele: Zum einen wird angestrebt, den Flächenbedarf zu reduzieren und den Ertrag von Nutzpflanzen zu steigern, etwa durch moderne Pflanzenzüchtung. Zum anderen gilt es, Treibhausgas-Emissionen und andere Umweltbelastungen in der landwirtschaftlichen Produktion zu senken. Eine exakt an den Standort angepasste Bewirtschaftung ist eine mögliche Lösung. Ressourcen wie Böden, Wasser und Nährstoffe müssen möglichst effizient und nachhaltig genutzt werden. Gleichzeitig gilt es, den Artenrückgang in der Agrarlandschaft aufzuhalten und die Biodiversität durch Ökosystem- und Strukturvielfalt zu stärken.
Moderne Pflanzenzüchtung zielt nicht nur darauf ab, Erträge zu steigern. Es geht auch darum, die Sortenvielfalt auszubauen und das Spektrum an interessanten Pflanzen-Inhaltsstoffen zu erhöhen. Gefragt sind insbesondere neue Sorten, die besser mit den Folgen des Klimawandels zurechtkommen, die also widerstandsfähig etwa gegenüber Trockenheit, Salzüberschuss und Schädlingsbefall sind. Moderne, wissensbasierte Pflanzenzüchtung kombiniert neueste Erkenntnisse aus Genetik und Molekularbiologie mit Methoden der modernen Agrartechnik sowie nachhaltigem Bodenmanagement. Zu den etablierten Züchtungstechniken haben sich neue Methoden gesellt, die als neue molekularbiologische Züchtungstechniken (NMT) bezeichnet werden. Dazu zählen unter anderem die Werkzeuge der Genom-Editierung (etwa die Genschere CRISPR-Cas), mit denen sich gezielter Veränderungen in das Erbgut von Nutzpflanzen einbringen lassen. Mit weiteren innovativen Züchtungsmethoden wie der Präzisionszüchtung auf der Basis molekularer Marker (Smart Breeding) oder Zellkulturtechniken erhalten Züchterinnen und Züchter wesentlich schneller und zielgerichteter als bisher ertragreiche Nutzpflanzensorten, die besser gegen Schädlinge, Krankheiten oder Wetterextreme gewappnet sind.
Eine zentrale Wissensbasis für die moderne Pflanzenzüchtung liefert die Genomforschung. Hier zählen deutsche Forscherteams zur Weltspitze. Sie erforschen etwa die Gerste, die hierzulande das zweitwichtigste Getreide ist. Trotz seiner Größe und Komplexität konnte das Gersten-Erbgut inzwischen vollständig entziffert werden. Ein internationales Konsortium unter Führung von Wissenschaftlern aus Gatersleben hat 2017 das Referenzgenom der Gerste veröffentlicht – die erste vollständige und hochaufgelöste Erbgut-Sequenz. Rund 5 Mrd. Basenpaare identifizierten die Fachleute und brachten sie in die richtige Reihenfolge. Mittlerweile sind die Forschenden dabei, das Pan-genom der Gerste zu analysieren, also die Gesamtheit der Genome der zahlreichen Varianten, die rund um den Globus existieren. Damit wird eine wertvolle Ressource für die globale Pflanzenzüchtung geschaffen.

Deutsche Forschende waren in den vergangenen Jahren zudem maßgeblich daran beteiligt, die riesigen Genome von Roggen und Brotweizen zu sequenzieren und zu analysieren. Das BMBF hat die Genomprojekte im Rahmen von Plant 2030 unterstützt. Aufbauend auf den Genomdaten unterstützt das BMEL mit dem Leuchtturmprojekt TERTIUS ein Konsortium, das ertragreiche Weizensorten züchten will, die über eine hohe Trockenstress-Toleranz verfügen. Dank stärker verzweigter und tiefer dringender Wurzeln sollen die Nutzpflanzen besser mit den immer häufigeren und längeren Trockenperioden in den Frühjahrs- und Sommerperioden zurechtkommen.
Hinzu kommen Forschungsansätze, die mithilfe modernster Techniken verschiedene Klimaszenarien im Gewächshaus simulieren können und darauf aufbauend Auswirkungen auf Wachstum und Ertrag errechnen können. Derartige Arbeiten werden unter anderem am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Bad Lauchstädt durchgeführt. Ein weiteres Forschungsfeld widmet sich dem Zusammenhang zwischen Pflanzen-Genen, der Umwelt und den äußeren Merkmalen, dem Phänotyp. Dies bestimmt Struktur, Funktion und effiziente Ausnutzung von Ressourcen dieser Pflanze.
Mit der Phänotypisierung werden Pflanzen nach komplexen äußeren Merkmalen oder Eigenschaften abgesucht und vermessen, ohne sie dabei zu verletzen oder zu zerstören. Dazu hat das BMBF den Aufbau des „Deutschen Pflanzen-Phänotypisierungs-Netzwerks“ (DPPN) unterstützt. In Jülich, München und Gatersleben sind moderne Hochdurchsatz-Anlagen zur Durchmusterung von Pflanzen entstanden.
Für Öko-Landwirte gehört nachhaltiges, biobasiertes Wirtschaften seit jeher zum Kern ihres Tuns. Sie legen Wert auf möglichst geschlossene Betriebskreisläufe und bauen das Futter für die Tiere hauptsächlich im eigenen Betrieb an. Auf leicht lösliche Mineraldünger und chemischen Pflanzenschutz wird verzichtet. Um die Böden fruchtbar zu halten, düngen Bio-Landwirte mit Mist oder Gülle oder sie bauen regelmäßig Hülsenfrüchte an. Während die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe insgesamt zurückgeht, steigt die Anzahl ökologisch wirtschaftender Betriebe stetig. 2020 gab es rund 35.400 Öko-Betriebe. Damit wirtschafteten rund 13,5 % aller landwirtschaftlichen Betriebe ökologisch. Eine zentrale Herausforderung im Öko-Landbau sind die niedrigeren Erträge im Vergleich zur konventionellen Bewirtschaftung. Entsprechend groß ist das Interesse an neuen Forschungserkenntnissen zur Landnutzung und Bodenfruchtbarkeit oder anderen Strategien, um Erträge nachhaltig zu steigern.
Hierbei gilt das Potenzial von Hülsenfrüchten, den Leguminosen, längst nicht als ausgeschöpft. Diese können dank Knöllchenbakterien an ihren Wurzeln Stickstoff aus der Luft fixieren. Sie düngen damit die Böden. Zudem sind sie reich an Eiweißen und damit wertvolle Proteinlieferanten. Das BMEL fördert im Rahmen der Eiweißpflanzenstrategie Projekte, die dem Anbau und der Züchtung von proteinhaltigen Lupinen, Soja, Erbsen und Ackerbohnen hierzulande wieder zu einem Aufschwung verhelfen sollen. Dazu gehören auch abwechslungsreiche Fruchtfolgen und Mischkulturen. So wird in einem BMEL-Projekt der Mischanbau von Mais und Stangenbohnen erprobt. Das ist nicht nur gut für die Bodenfruchtbarkeit, sondern wirkt sich potenziell auch positiv auf die Biodiversität aus und verringert die Bodenerosion.
In dem vom BMBF geförderten Projekt IMPAC3 wurden von Forschenden der Universität Göttingen beispielsweise Mischkulturen in verschiedenen Anbausystemen untersucht. So wurde auf Ackerflächen unter anderem der gemeinsame Anbau von Winterweizen und Winterackerbohne untersucht. Die Ergebnisse des Feldversuchs sind vielversprechend: So konnte durch den gemeinsamen Anbau die Stickstoffversorgung des Weizens im Vergleich zur Reinkultur um 40 % gesteigert, der Düngebedarf reduziert und der Ertrag um mehr als 30 % gesteigert werden.
Die zehn Bodenforschungsverbünde der BMBF-Fördermaßnahme „Boden als nachhaltige Ressource“ (BonaRes) loten ebenfalls neue Konzepte und Strategien für ein nachhaltiges Bodenmanagement aus. Das soll nicht nur die Bodenfruchtbarkeit steigern, sondern kann auch die Funktion der Böden als Kohlenstoffspeicher stärken. Neben neuartigen Fruchtfolgen – etwa dem Anbau von Zwischenfrüchten wie Klee, Ackersenf oder der Bienenweide Phacelia – untersuchen die BonaRes-Teams zum Beispiel, wie sich die mikrobielle Lebensgemeinschaft im Boden, das Mikrobiom, günstig beeinflussen lässt. Die Wechselwirkungen von Pflanzenwurzel und ihrer direkten Umgebung im Boden steht im Fokus einer weiteren BMBF-Fördermaßnahme.

Die Weiterentwicklung der Landwirtschaft im Sinne einer nachhaltigen und ressourceneffizienten Bewirtschaftung ist unter anderem dem immensen technologischen Fortschritt der vergangenen Jahrzehnte zu verdanken. Auch in der Landwirtschaft ist die Digitalisierung in vollem Gange: Es gibt mittlerweile viele öffentliche digitale Informationen zum Boden, zur Landnutzung oder zum Klima. Zudem steigt die zur Verfügung stehende Menge an Daten, die durch Luftaufnahmen von Drohnen oder Erdbeobachtungssatelliten entstehen. Traktoren und andere Landmaschinen werden zunehmend mit Sensoren und Messtechnik ausgestattet, welche den Zustand des Bodens oder der Pflanzen erfassen können.
Landwirtschaftliche Maschinen können so den Wasser- und Nährstoffbedarf der Feldfrüchte ermitteln. Leistungsfähige Informatikanwendungen wie Künstliche Intelligenz (KI) helfen bei der Auswertung der riesigen Datenmengen. Werden die aktuellen Satelliten- und Wetterdaten berücksichtigt, können Pflanzen bedarfsgerecht und punktgenau bewässert, gedüngt oder von Unkraut befreit werden. Dadurch steigen nicht nur die Effizienz und der Ertrag. Insgesamt verringert sich so der Eintrag überschüssiger Nährstoffe in die Umwelt und die Kosten für Dünger, Pflanzenschutzmittel und Saatgut sinken.
Um der zunehmenden Bodenverdichtung durch große Maschinen entgegenzuwirken, eignen sich kleine, autonom betriebene und GPS-gesteuerte Feld- und Ernteroboter oder Drohnen. Die Digitalisierung ebnet damit den Weg hin zu einer Präzisionslandwirtschaft, die ressourceneffizient und umweltschonend ist. Sie erlaubt zudem eine kleinteiligere und sogar punktgenaue Bewirtschaftung von Ackerflächen. Digitale Helfer unterstützen auch die Tierhaltung: Sensor- und Messtechnik helfen im Stall durch Aktivitätsmessung, bei der bedarfsgerechten Fütterung, beim Melken oder bei der Überwachung des Gesundheitszustands der Tiere. Digitale Technologien bergen damit enormes Potenzial für einen schonenden und nachhaltigen Anbau und eine artgerechte Viehhaltung. Eine Landwirtschaft 4.0 mit intelligent vernetzten Maschinen und Systemen und dem Einsatz von KI und weiterer IT-Anwendungen spielt im Rahmen der BMBF-Förderinitiative Agrarsysteme der Zukunft eine bedeutende Rolle. Das BMEL fördert zum Thema unter anderem sogenannte digitale Experimentierfelder in der Landwirtschaft und hat einen Förderschwerpunkt „Gartenbau 4.0“ initiiert.
Im Gegensatz zur Landwirtschaft gestaltet sich die Digitalisierung in der Forstwirtschaft bislang verhalten. Während die großen Betriebe des privaten und öffentlichen Waldbesitzes und der Holzindustrie ihre Geschäftsprozesse – wenngleich vornehmlich mit Einzellösungen – zum Teil bereits digitalisiert haben, dominieren im Kleinprivatwald und in kleineren Unternehmen eher Zurückhaltung und Nachholbedarf. Eine digitale Vernetzung entlang der gesamten Wertschöpfungskette Wald und Holz lässt noch auf sich warten. Doch mithilfe der Förderpolitik der Bundesregierung rücken Lösungen ins Blickfeld.
In einer 2022 veröffentlichten Online-Umfrage des Deutschen Forstwirtschaftsrates und der Arbeitsgemeinschaft Rohholz zur Verbreitung der Digitalisierung in der deutschen und der österreichischen Forst- und Holzwirtschaft gaben 94 % der 256 befragten Unternehmen an, dem Thema Digitalisierung gegenüber aufgeschlossen zu sein. Im Gegensatz dazu mangelt es 65 % der Umfrageteilnehmer allerdings aktuell an tatsächlicher Bereitschaft zur Umsetzung digitaler Projekte im Cluster Forst und Holz. Als größtes Hemmnis bei der Umsetzung benennen die Befragten bislang fehlende standardisierte Geschäftsprozesse, dabei insbesondere einheitliche Schnittstellen für den Datenaustausch. Die unzureichende Netzabdeckung im Wald und die unbefriedigende Breitband-Internetanbindung im ländlichen Raum stellen neben Bedenken in puncto Datenschutz und IT-Sicherheit weitere Hemmnisse dar.
Für die effizientere Holzbereitstellung und -verarbeitung bietet die Digitalisierung im Cluster Forst und Holz aber unverzichtbare Möglichkeiten. Inzwischen sind bundesweit zahlreiche Initiativen und Projekte entstanden, die das Thema vorantreiben. Allein das BMEL fördert über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. aktuell 15 Forschungsverbünde mit mehr als 40 Einzelvorhaben zu Aspekten der Digitalisierung entlang der Wertschöpfungskette Forst und Holz. Im Forschungsprojekt Smart Forestry wird beispielsweise ein clusterübergreifendes Verfahren für die intelligente und vollintegrierte Holzernte entwickelt. Die an den Prinzipien von Wald und Holz 4.0 orientierten Wertschöpfungsnetzwerke beruhen auf der Vernetzung aller an der Holzernte beteiligten Akteure und Systeme über digitale Zwillinge im „Internet der Dinge“.
Im Projekt Contura widmet sich ein Forschungs- und Praxisverbund der Entwicklung eines Systems zur digitalen Zustandserfassung forstlicher Wege. Das auf einem künstlichen neuronalen Netzwerk basierende System speichert beim Befahren eines Forstweges Informationen über dessen Beschaffenheit in einem Datensatz. Mit diesen Daten wird ein digitaler Zwilling des Weges erstellt; eine aktuelle Momentaufnahme des realen Objektes wird digital gespeichert. Nach Erfassung und Bewertung des realen Wegezustands dient der digitale Zwilling als Grundlage für die Planung der Wege-Instandhaltung – eine Voraussetzung für Waldarbeit und Holzernte.
Holzproduktion an den Klimawandel anpassen
Der Wald stellt mit dem Holz einen Großteil der in Deutschland verwendeten nachwachsenden Rohstoffe bereit. Gleichzeitig speichern Waldbäume Kohlenstoff aus CO2 in ihre Biomasse ein und tragen damit wesentlich zum Klimaschutz bei. Die großen Herausforderungen sind wie bei der Landwirtschaft auch die Sicherung der nachhaltigen Rohstoffversorgung und die Anpassung an den Klimawandel. Ausgelöst durch Dürren und Stürme haben Kalamitäten den Wäldern insbesondere in den Jahren 2018 bis 2020 stark zugesetzt, der Borkenkäfer hat sich massiv ausgebreitet.

Neben dem Waldumbau hin zu klimaangepassten Mischwäldern mit standortgerechten Baumarten kommt der Forstpflanzenzüchtung eine wichtige Bedeutung zu, um die Versorgung mit hochwertigem forstlichen Vermehrungsgut zu sichern. Gerade bei Bäumen gestaltet sich die Züchtung besonders aufwendig und erstreckt sich über lange Zeiträume. Im Rahmen einer Züchtungsstrategie haben Bund und Länder ihre Ressourcen gebündelt, um sechs Baum-arten (Douglasie, Lärche, Bergahorn, Fichte, Kiefer, Eiche) für den Wald der Zukunft fit zu machen.
Daneben hat die Bund-Länderarbeitsgruppe Forstgenressourcen und Forstsaatgutrecht (BLAG-FGR) 2021 ein länderübergreifendes Konzept zur Identifizierung von für Deutschland relevanten Baumarten im Klimawandel zur Anlage von Vergleichsanbauten veröffentlicht. Ziel der Bundesregierung ist es, eine ausgewogene und tragfähige Balance zwischen den steigenden und teilweise konkurrierenden Ansprüchen der Gesellschaft an den Wald und seiner nachhaltigen Leistungsfähigkeit zu finden. Das hat das BMEL in der Charta für Holz 2.0 adressiert (vgl. Kap. Die Rohstoffquellen der Bioökonomie). Auch die „Waldstrategie 2050“ greift dieses Leitbild auf und formuliert Maßnahmen für eine nachhaltige Waldentwicklung.
Bäume können auch die Landwirtschaft bereichern. Kurzumtriebsplantagen sind Äcker, auf denen schnellwachsende Hölzer wie Pappeln und Weiden angebaut werden. Diese Dauerkulturen sind nach wenigen Jahren erntereif. Das BMEL hat verschiedene Pflanzenzüchtungsprojekte gefördert, um Baumarten für einen wirtschaftlichen Anbau in Kurzumtriebsplantagen zu erschließen. In Agroforstsystemen werden Gehölze – Bäume oder Sträucher – mit Ackerkulturen und Tierhaltung auf der gleichen Fläche kombiniert. Durch die verschiedenen Komponenten sollen ökologische und wirtschaftliche Vorteile entstehen. Agroforstsysteme geraten auch als potenzielle Klimaschützer in den Blick: Sie könnten eine Strategie sein, um die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre zu steigern. Das BMEL und das BMBF fördern mehrere Forschungsprojekte zu Agroforstsystemen.
Geschlossene Produktionssysteme
Dank neuer Technologien sind in den vergangenen Jahren zudem immer ausgereiftere geschlossene Produktionssysteme entstanden. Hochgradig kontrollierte Produktionsbedingungen erlauben es, ganzjährig Obst und Gemüse anzubauen und Nutztiere zu halten. Sogenannte Indoor-Farmen sind in der Regel platzsparende Produktionssysteme mit weitgehend geschlossenen Stoff- und Energieströmen und gekoppelten Kreisläufen. Durch die Verlegung der Nahrungsmittelproduktion in geschlossene, beheizte und künstlich beleuchtete Räume wird eine orts- und klimaunabhängige landwirtschaftliche Produktion in großem Maßstab möglich.
Unterstützt vom BMBF hat das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) zum Beispiel eine emissionsfreie Aquaponik-Anlage entwickelt, die Buntbarsche und Tomaten gemeinsam gedeihen lässt. In dem Agrarsysteme-der-Zukunft-Projekt CUBES Circle werden geschlossene Produktionsmodule zur Kultur von Fischen, Pflanzen und Insekten smart miteinander vernetzt und die Stoff- und Energieflüsse zu einem Gesamtsystem verbunden. Andere innovative Konzepte setzen darauf, den Anbau von Pflanzen in den städtischen Lebensraum zu integrieren – etwa auf Dächern oder an Fassaden.

Immer mehr Akteure setzen auf Urban Farming, um die Nachfrage nach regionalen Produkten zu bedienen sowie vor Ort anfallende Rest- und Abfallstoffe oder Abwärme gezielt zu nutzen. So werden in dem Projekt SUSKULT, das vom Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT) koordiniert wird, Kläranlagen zum Nährstofflieferanten für den Gemüseanbau in hydroponischen Anlagen. In diesem Agrarsystem der Zukunft wird unter anderem der Anbau von Salat, Wasserlinsen oder Süßkartoffeln erprobt. Indoor-Farming-Ansätze spielen auch im Innovationsraum NewFoodSystems eine wichtige Rolle (vgl. Ernährung).