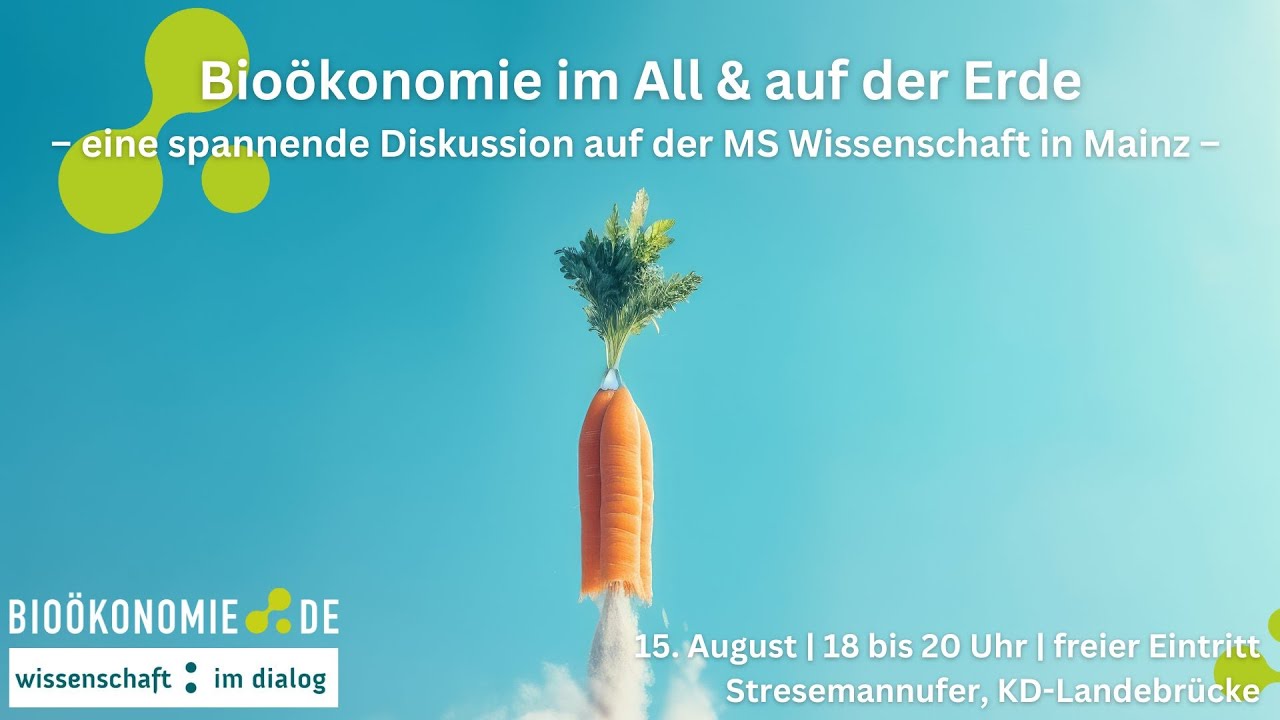Wer sein Wohnzimmer streicht, denkt selten darüber nach, was genau in der Farbe steckt, die künftig die Wände ziert. Die Hauptsache ist, dass sie gut deckt, schnell trocknet und nicht unangenehm riecht. Doch diese Farben enthalten meist synthetische Bindemittel, die aus fossilen Rohstoffen gewonnen werden und oftmals gesundheitlich umstritten sind. Forschende des Fraunhofer-Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV) in Freising haben daher gemeinsam mit der Firma Habich Farben eine umweltfreundliche Alternative entwickelt: „Wir wollten Acrylat-basierte Bindemittel durch biobasierte Alternativen ersetzen, und dazu bieten sich Proteine sehr gut an“, so IVV-Experte Thomas Herfellner.
Das Ziel: nachhaltige Alternativen zu Acrylaten
Bisher basieren die meisten Dispersionsfarben – typische Wand- und Deckenfarben – auf Acrylaten, künstlich hergestellte Stoffe, aus denen zum Beispiel Kleber, Lacke oder Kunststoffe hergestellt werden. Sie sorgen in der Farbrezeptur dafür, dass die Farbpigmente gut an der Wand haften und der Anstrich haltbar bleibt. Doch Acrylate haben einen großen ökologischen Fußabdruck und stehen im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein.
Die alternative Idee, pflanzliche Proteine als Bindemittel zu nutzen, ist nicht neu. Schon in der Antike wurden Eiweiße aus Milch oder Pflanzen für Farben und Lacke verwendet. Doch moderne Dispersionsfarben müssen strengen Anforderungen genügen: Sie sollen beispielsweise stabil, wasserbeständig und einfach zu verwenden sein. Hier setzten die Forschenden mit dem Projekt DisPro an und untersuchten, wie sich pflanzliche Proteine modifizieren lassen, um mit synthetischen Bindemitteln mitzuhalten.
„Proteine sind Knäuel, aus denen an der Oberfläche Aminosäurereste herausragen“, veranschaulicht Herfellner. „Wir hängen an diese Reste enzymatisch oder durch eine chemische Reaktion funktionelle Gruppen an, um spezielle Eigenschaften einzustellen.“ Unter funktionellen Gruppen verstehen Chemiker bestimmte Atomgruppen innerhalb eines Moleküls, die dessen chemische Eigenschaften und Reaktivität maßgeblich bestimmen.
Für jede Anwendung ein neuer Prozess
Welche funktionellen Gruppen für bestimmte Eigenschaften infrage kommen, ist in der Chemie grundsätzlich bekannt. Die Herausforderung besteht jedoch jedes Mal aufs Neue darin, für die jeweilige Anwendung die Prozesse zu entwickeln, um diese Modifikationen vorzunehmen. „Für eine Holzlasur oder einen Klebstoff wäre das Verfahren anders“, erklärt Herfellner.
Zunächst erfolgen die Experimente im Ein-Liter-Maßstab im Labor. „Man probiert systematisch einen Baukasten an Substanzen aus und optimiert immer wieder Konzentration, Temperatur, pH-Wert und mehr“, beschreibt er das Vorgehen. „Jeder Versuch wird dann analysiert, etwa wie homogen die Modellrezeptur damit wird, ob sich die Komponenten entmischen oder wie abrieb- und wasserbeständig die Farbe ist.“ Anschließend müssen sich vielversprechende Kandidaten im Technikum im Maßstab von 200 bis 300 Litern beweisen.

Proteine aus Erbsen und Soja
Im Forschungsprojekt DisPro haben die Fachleute verschiedene pflanzliche Proteinquellen getestet. Ziel war es, ein Bindemittel zu entwickeln, das sich einfach in herkömmliche Rezepturen für Dispersionsfarben integrieren lässt. Als besonders vielversprechend erwiesen sich Erbsen- und Sojaproteine.
In Tests konnte das Team bereits 75 % der konventionellen Acrylate in Dispersionsfarben ersetzen, ohne dass eine Anpassung der Rezeptur nötig war. Das zeigt, dass eine nachhaltigere Produktion von Farben in greifbare Nähe rückt, ohne Kompromisse bei der Qualität eingehen zu müssen oder ganz neue Farbrezepturen zu entwickeln.
„Die letzten 25 % lassen sich auch noch schließen“, zeigt sich Herfellner überzeugt. Das sei weniger eine chemische Herausforderung als eine Kostenfrage. Denn die Erdölchemie hat Jahrzehnte Entwicklungsvorsprung und ist sehr billig in der Herstellung. „Dafür vermeiden biobasierte Produkte negative gesundheitliche Auswirkungen der Acrylate vor allem bei Innenraumanwendungen und sind in der Nachhaltigkeit deutlich besser“, betont der Forscher.
Alltagstauglicher als erwartet
Um die neuen Bindemittel auf ihre Alltagstauglichkeit zu testen, wurden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt. Neben der Haftung und Wasserbeständigkeit spielten auch die Lagerstabilität und die mechanischen Eigenschaften eine Rolle. Dabei zeigte sich, dass die Farben über zwölf Monate stabil blieben und nur geringe Veränderungen in der Zusammensetzung aufwiesen. „Das war für uns eine tolle Bestätigung unserer Arbeit“, erinnert sich Herfellner. Auch die Homogenität und das Anmischen für den Verbraucher seien ähnlich wie bei konventionellen Produkten.
Allerdings bleiben Herausforderungen: Während der teilweise Ersatz der Acrylate gut funktionierte, zeigten die Tests, dass bei einem vollständigen Austausch die Nassabriebklasse der Farben – also ihre Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb beim Reinigen – schlechter wurde. Daher arbeiten die Forschenden weiter daran, die Proteine zu optimieren, um auch diese Hürde zu überwinden. Ein erstes Vorläuferprodukt hat Projektpartner Habich bereits entwickelt.
Das Projekt DisPro
Das Projekt DisPro lief vom 1. Juni 2021 bis zum 31. Mai 2024. Es wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit rund 420.000 Euro gefördert. Beteiligt waren die Firma Habich Farben und das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV.
Nächste Herausforderung: Wirtschaftlichkeit
Das Forschungsprojekt zeigt, dass pflanzliche Proteine ein enormes Potenzial haben. Die Ergebnisse sind so vielversprechend, dass am Fraunhofer IVV bereits weitere Projekte geplant sind – etwa für den Einsatz von biobasierten Bindemitteln in der Holz- und Möbelindustrie oder in der Verpackungsbranche. „Wir arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, diese nachhaltigen Bindemittel zu optimieren und bis zur Marktreife zu bringen“, resümiert Herfellner.
Autor: Björn Lohmann