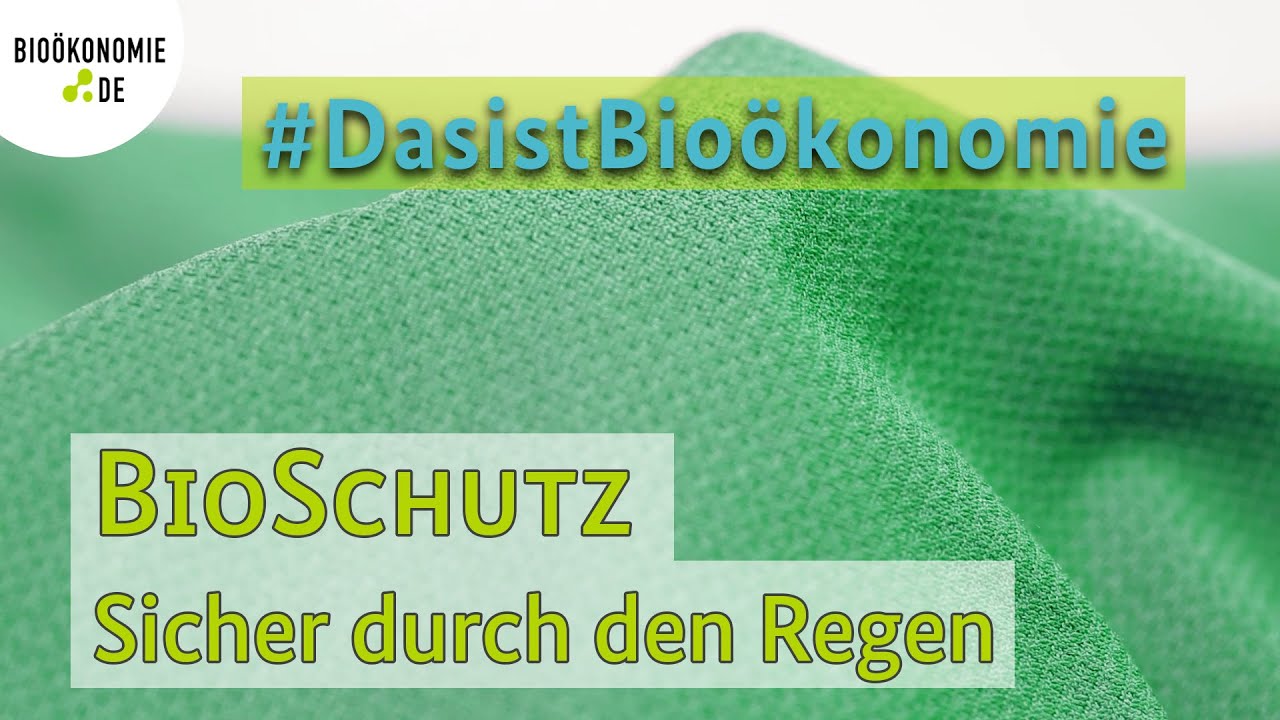Alternativen zu Leder und fossilem Kunstleder
Vor allem seit den 2000er-Jahren haben die Einführung neuer Standards und technologische Fortschritte zu Verbesserungen in der globalen Lederproduktion geführt. In Schwellen- und Entwicklungsländern, in denen ein großer Teil der Herstellung und Veredelung stattfindet, sind jedoch weiterhin erhebliche Umwelt- und Gesundheitsbelastungen dokumentiert. Diese resultieren vor allem aus dem Einsatz chemischer, ätzender Substanzen sowie aus einer unzureichenden Abwasser- und Abfallbehandlung. Zudem gehen die Produktionsprozesse in der Regel mit hohen Treibhausgasemissionen und einem sehr großen Wasserverbrauch einher. Da die eingesetzten Rohhäute überwiegend aus der industriellen Massentierhaltung stammen, ist die Lederproduktion indirekt auch mit einer Zunahme von Tierleid verbunden.
Kunstleder aus PVC oder PU bieten zwar eine Alternative, bringen jedoch auch Umweltbelastungen mit sich. Als erdölbasierte Kunststoffe sind sie nicht biologisch abbaubar und können bei der Herstellung und Entsorgung Schadstoffe sowie Mikroplastik durch Abrieb freisetzen.
Biodesign: Wo sich biologisches Wissen und Kreativität treffen
Die Verbindung von biologischem Wissen, Neugierde und Kreativität zeigt immer wieder, wie neue Wege eingeschlagen und bisher manifestierte Produkte und Prozesse grundlegend verändert werden können. Mitunter wird dieses interdisziplinäre Feld dem Biodesign-Ansatz zugeschrieben und als Nutzung biologischer Systeme, Verfahren und Organismen zur Entwicklung innovativer Lösungen definiert.
Im Bereich nachhaltige Lederalternativen resultiert daraus ein breites Spektrum an Möglichkeiten, die nachstehend anhand dieser drei Kategorien veranschaulicht werden: Pflanzen/pflanzliche Reststoffe, Pilze und Algen.

Die Bedeutung der Biotechnologie
In jedem dieser drei Bereiche ist die Biotechnologie von zunehmender Bedeutung, da ihre Verfahren gezielt für die Materialherstellung genutzt werden können. Zentral ist dabei die Fermentation, bei der Mikroorganismen oder Enzyme organische Substanzen umwandeln und so wertvolle Biopolymere erzeugen. Durch kontrollierte Fermentationsprozesse lassen sich unter anderem Zellulose, Myzel, Alginat oder bakterielle Kollagenanaloga herstellen – Stoffe, die aufgrund ihrer strukturellen Eigenschaften als Grundlage für lederähnliche Materialien dienen. Allerdings entstehen biobasierte Lederalternativen nicht ausschließlich durch biotechnologische Verfahren. Auch mechanische, (bio-)chemische oder kombinierte Prozesse auf Basis von erneuerbaren Rohstoffen können zu nachhaltigen Materialien führen.
Seite 2 von 5
1. Pflanzen/ pflanzliche Reststoffe
Pflanzen sowie pflanzliche Rest- und Abfallstoffe eignen sich gut für die Herstellung von Lederalternativen, weil sie reich an Fasern, Pektinen und Zellstrukturen sind, die sich zu flexiblen und biologisch abbaubaren Materialien verarbeiten lassen. Hinzu kommt, dass ihre Kohlenhydrate und enthaltene Mineralstoffe als Grundlage für Fermentationsverfahren dienen können.
Obstabfälle
Obst und Gemüse werden in Deutschland sehr häufig weggeworfen, über den Hausmüll, von Supermärkten oder sie verlassen nicht einmal das Gewächshaus. Um aus diesen Reststoffen lederähnliche Filamente herzustellen, kann auf unterschiedliche Verfahren zurückgegriffen werden.

Ein Beispiel für einen solchen Prozess ist die mikrobielle Fermentation, bei der bakterielle Zellulose entsteht. Die in den Reststoffen enthaltenen Nährstoffe und Zucker dienen dabei als Substrat für spezielle Bakterien, die unter kontrollierten Bedingungen in einem Bioreaktor kultiviert werden. Dadurch wird eine konstante und skalierbare Produktion ermöglicht. Während der Fermentation wandeln die Bakterien die Zucker in feine Zellulosefasern um, die sich zu einem dichten, zusammenhängenden Gewebe verbinden. Nach Abschluss des Prozesses wird die Zellulose geerntet, gereinigt und weiterverarbeitet, sodass ein hochreines und robustes Material entsteht. Beim Unternehmen Polybion.Bio kommen hierfür ausgewählte Essigbakterien zum Einsatz, die unter anderem mit Zitrusresten „gefüttert“ werden. Das daraus entstehende, lederähnliche Material Celium™ dient als Grundlage für die Herstellung von Taschen und Kleidungsstücken.
Mangos mit Beschädigungen oder aus Überproduktionen kommen bei dem niederländischen Start-up Fruitleather Rotterdam in einem anderen Verfahren zum Einsatz: Zunächst werden die Südfrüchte entkernt, zu Mus zerdrückt und mit diversen Zusatzstoffen vermengt. Auf Bleche gestrichen wird die Masse in einem Entfeuchter zu Platten getrocknet, bevor Schichten einer schützenden Glasur und mehrere Harzlagen folgen. Dieser Vorgang wird mehrfach wiederholt und findet unter hohem Druck und Hitze statt, die die Widerstandsfähigkeit des Materials erhöhen. Eine Prägemaschine sorgt in einem letzten Schritt dafür, dass das entstandene Fruchtleder in Haptik und Optik dem tierischen Pendant sehr nahekommt.

Holz und Hanf
Holz und Hanf enthalten große Mengen an Zellulose, Hemizellulose und Lignin, die als natürliche Gerüststoffe für Festigkeit, Stabilität und Formbarkeit sorgen. Diese Eigenschaften machen sie zu geeigneten Ausgangsstoffen für die Herstellung von robusten, flexiblen Materialien.
Das deutsche Start-up Revoltech erkannte dieses Potenzial und entwickelte im Rahmen der Förderinitiative KMU-innovativ des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) einen Lederersatz aus Hanfresten (siehe Biopionier). Dabei setzten die Hessen auf die faserhaltigen Hanfrückstände, die nach der Ernte übrigbleiben und normalerweise als Abfall gelten. Für die Herstellung des Materials LOVR™ werden die Fasern mit natürlichen Additiven wie Wachsen, Pigmenten und Bindemitteln kombiniert und zu einer homogenen Masse verarbeitet. Diese wird industriell gepresst, geglättet und getrocknet. Das Ergebnis ist ein lederähnlicher Werkstoff ohne zusätzliche Kunststoffträger oder synthetische Beschichtungen, der vollständig biobasiert, recycelbar und biologisch abbaubar ist.
Das Karlsruher Unternehmen NUO stellt ein veganes Lederimitat her, für das es als Basis sehr dünne Holzfurniere mit einem Baumwolltextilträger verbindet. Anschließend wird die Holzoberfläche mit feinen Laserschnitten graviert, um dem Material ein hohes Maß an Flexibilität zu verleihen. Zum Abschluss kann je nach Anwendungsfall eine Schutzschicht aufgebracht werden, die das Holz widerstandsfähiger gegenüber Feuchtigkeit und Abnutzung macht.
Kokoswasser
In der indischen Agrarindustrie fällt Kokoswasser häufig als Nebenprodukt der Kokosnussverarbeitung an, da es für die Gewinnung von Fruchtfleisch oder Öl nicht benötigt wird. Es eignet sich jedoch ideal als Nährlösung für Fermentationsverfahren: Nach der Sterilisation des Kokoswassers beginnt eine zweiwöchige Fermentation, bei der Bakterien die enthaltenen Nährstoffe in ein festes Gel umwandeln. Dieses wird anschließend mit Naturfasern und pflanzlichen Harzen vermengt und getrocknet. So entsteht ein flexibles, wasserabweisendes und strapazierfähiges Biomaterial, das in Struktur und Haptik an eine Mischung aus Leder und Papier erinnert. Das in Kerala gegründete Start-up Malai nutzt dieses Verfahren und beliefert heute Marken weltweit, die daraus unter anderem Armbänder für Smartwatches und Portemonnaies fertigen.

Kaffeesatz
Der Kaffeeproduzent Nespresso hat gemeinsam mit dem französischen Start-up Zèta einen Sneaker entwickelt, der teilweise aus recyceltem Kaffeesatz besteht. Für ein Paar Schuhe werden die Kaffeereste von rund zwölf Tassen Kaffee genutzt, die sowohl im kunstlederartigen Obermaterial als auch in der Innen- und Laufsohle verarbeitet sind. Ergänzt wird dies durch weitere Recyclingmaterialien wie Kork, Kautschuk, Latex und Polyester. Ganz plastikfrei sind die Schuhe damit zwar nicht, sie bestehen jedoch zu rund 80 % aus recycelten oder biobasierten Komponenten.
Exkurs: Kultiviertes Leder
Was bei Fleisch bereits gelingt, lässt sich auch auf Leder übertragen. Mithilfe eines Gewebebioreaktors kann kultiviertes Ledermaterial im Labor gezüchtet und kommerziell hergestellt werden. Dabei wird einer lebenden Kuh eine kleine Probe von Hautzellen entnommen, die anschließend im Labor vermehrt werden. So entsteht ein Material, das Festigkeit, Haltbarkeit und Optik von herkömmlichem Leder tierischen Ursprungs nahezu identisch reproduziert.
Kork und Kautschuk
Eine plastikfreie Lederalternative lässt sich außerdem aus Leinen und Kork herstellen – traditionelle, bewährte Materialien, die mit einem innovativen Ansatz das neuartige Material CORKonLINEN ergeben. Dafür werden die Rinden portugiesischer Korkbäume von Hand leicht überlappend auf das Leinengewebe aufgebracht, mit einem wasserbasierten Naturkleber fixiert, zusammengedrückt und anschließend in mehreren Schritten manuell geschliffen. So entsteht eine glatte, weiche Oberfläche mit gleichmäßiger Struktur und das lederähnliche Gewebe kann zu Produkten verarbeitet werden.

Neben vielen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ist das Interesse für biobasiertes Leder auch bei immer mehr Großunternehmen anzutreffen, beispielsweise bei BMW. Im Jahr 2023 hat der Münchener Autobauer das innovative Material Mirum® als Option für die Innenausstattung aufgenommen. Das widerstandsfähige Gewebe besteht vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen wie Naturkautschuk, pflanzlichen Ölen und Wachsen, natürlichen Pigmenten sowie Mineralien. Entwickelt wurde Mirum® vom amerikanischen Technologieunternehmen Natural Fiber Welding. Neben BMW setzen inzwischen auch andere Marken aus der Mode- und Automobilindustrie auf Mirum®, da es eine vergleichbare Haptik und Haltbarkeit wie Leder bietet und gleichzeitig eine deutlich bessere Umweltbilanz aufweist.
Seite 3 von 5
2. Pilze
In der Bioökonomie werden Pilze für vielfältige Anwendungen genutzt, immer häufiger auch zur Herstellung lederähnlicher Materialien. Zum Einsatz kommen sowohl Makro- (mit bloßem Auge sichtbare Pilze) als auch Mikropilze. Wichtigstes Strukturelement ist das Myzel, ein aus Zellfäden bestehendes Geflecht, das im Substrat wächst und zur Nährstoffaufnahme dient.
Auf landwirtschaftlichen Reststoffen kultiviertes Myzel kann zu einem stabilen, atmungsaktiven und biologisch abbaubaren Verbundmaterial heranwachsen, das ressourcenschonend und nahezu emissionsfrei produziert wird. Darüber hinaus ist auch eine direkte stoffliche Nutzung von Pilzbestandteilen möglich, etwa durch die Verarbeitung der Fruchtkörper ausgewählter Makropilze zu lederähnlichen Werkstoffen.
Pilze und ihr Myzel können darüber hinaus Abfallstoffe in wertvolle Rohstoffe umwandeln. Ein Beispiel ist das vom BMFTR geförderte Projekt BasiCALT, bei dem Speisepilze aus der Gruppe der Basidiomyceten eingesetzt werden, um regionale Reststoffe der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft zu verwerten. Ziel bis Ende 2026 ist unter anderem die Entwicklung von veganem Leder sowie weiterer biobasierter Materialien. Beteiligt sind die Hochschule Niederrhein und das Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen.
Zunderschwamm
Der holzbewohnende Zunderschwamm (Fomes fomentarius) ist ein gutes Beispiel für einen Makropilz, der als vielversprechender Rohstoff für biobasierte Materialien und Lederalternativen gilt. Er wächst in mehreren festen Schichten und bildet ein besonders zähes, faseriges Gewebe, das leicht, stabil und formbar ist. Für die Verarbeitung wird der Pilzfruchtkörper geerntet, getrocknet und in dünne Schichten geschnitten. Diese werden mechanisch aufbereitet, geglättet und oft durch Kochen, Klopfen oder Pressen weiter verdichtet, bis ein weiches Material entsteht. Anschließend kann das Gewebe zugeschnitten, genäht und gefärbt werden. Kleine Manufakturen und inzwischen auch einige größere Unternehmen nutzen dieses Naturmaterial bereits für die Herstellung von Accessoires wie Taschen, Geldbörsen und Hüten.

Myzel
Durch gezielte Steuerung der Umweltbedingungen lässt sich das Wachstum von Myzel kontrollieren und die Struktur des Geflechts präzise beeinflussen. Ein herausragendes Beispiel für eine technologische Anwendung bietet das patentierte Verfahren Fine Mycelium™ des US-amerikanischen Unternehmens MycoWorks. Unter streng kontrollierten Bedingungen entsteht hierbei ein dreidimensionales, dicht verflochtenes Myzelnetzwerk, dessen Dicke, Festigkeit und Textur reproduzierbar angepasst werden können.

Auf dieser Grundlage wird das Material Reishi™ hergestellt: ein Lederalternativprodukt mit hoher mechanischer Stabilität, lederähnlicher Haptik und vielfältigen gestalterischen Eigenschaften. Reishi™ findet bereits Anwendung in der Automobil-, Mode- und Luxusgüterindustrie, unter anderem in Kooperation mit General Motors, und gilt als einer der derzeit technologisch fortschrittlichsten Ansätze zur Herstellung von Myzel-basierten Lederalternativen.
Seite 4 von 5
3. Algen
Aufgrund ihres schnellen Wachstums und hohen Gehalts an biopolymeren Strukturen wie Zellulose, Alginate oder Carrageen eignen sich Algen ebenso als vielversprechende Basis für ressourcenschonende Lederalternativen. Anders als viele Landpflanzen benötigen sie keine Ackerflächen und der Anbau bestimmter Arten kann durch die Aufnahme von überschüssigen Nährstoffen wie Stickstoff und Phosphor außerdem zur Verbesserung der Wasserqualität beitragen. Damit leisten Algen einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der Eutrophierung, einem Prozess, zu dem neben der konventionellen Lederproduktion durch Abwässer auch die Landwirtschaft durch Nährstoffeinträge maßgeblich beiträgt.
Kleidung und Accessoires
Biodesignerin und Materialforscherin Bea Brücker hat dieses Potenzial erkannt und fertigt in kleinem Maßstab mit Hilfe von Mikroorganismen nachhaltige Kleidungsstücke aus Algen. Mehr dazu in diesem Video.
Das sogenannte Kudarat Bioleder des National Institute of Design in Ahmedabad besteht aus Zellulosefasern, die mithilfe natürlicher Bindemittel, Biopolymeren aus Algen und biobasierter Imprägnierstoffe zu Platten verbunden werden. Die Einfärbung des Materials erfolgt mit Pigmenten aus Lebensmittel- und Blumenresten, etwa Gemüseschalen, Rosen oder Ringelblumen.

Beim „amphibischen Leder“ stehen ebenfalls Zellulose sowie Sargassum, eine Gattung frei treibender Braunalgen (Phaeophyceae), im Mittelpunkt. Diese Algen haben sich in den vergangenen Jahren vor allem im Atlantik zwischen dem Golf von Mexiko und Westafrika stark ausgebreitet, wo sie dichte Schwimmteppiche bilden. Durch ihre Masse blockieren sie das Sonnenlicht an der Wasseroberfläche und setzen beim Zersetzungsprozess giftige Stoffe frei, die Meeresökosysteme belasten. Das von der Aalto Universität entwickelte Material lässt sich gut vernähen und eignet sich etwa für die Herstellung von Taschen.
Interior
Auch im Interiorbereich spielen biobasierte Lederalternativen eine Rolle, etwa bei der Forschungskooperation zwischen IKEA of Sweden und der Lund University School of Industrial Design, die das Potenzial mariner Materialien zur Entwicklung umweltfreundlicher Textilien mit geringem oder sogar negativem CO₂-Fußabdruck erforscht haben. Im Rahmen dieses Projekts entstand der Prototyp „Sea Leather“, ein Material, das überwiegend aus Alginat besteht, einem aus Braunalgen gewonnenen Polysaccharid. Diese weltweit verbreitete Algenart wurde aufgrund ihres hohen Alginatgehalts und ihrer Fähigkeit, CO₂ zu binden, ausgewählt. Ein Ziel der Studie war es, das Bewusstsein für die Bedeutung mariner Materialien als alternative Rohstoffe für Textilien zu schärfen.
Dass Lederalternativen aus Algen nicht nur zur gesellschaftlichen Bewusstseinsschärfung beitragen können, beweist erneut das Darmstädter Start-up Revoltech. Neben Hanf kommen bei dem Unternehmen auch Algen zum Einsatz (siehe Biopionier). Seine Materialinnovation MATTR™ besteht überwiegend aus Algenbiomasse, ergänzt durch natürliche Zusatzstoffe und ein zellulosebasiertes Trägermaterial. Derzeit befindet sich die plastikfreie Lederalternative noch in der Pilot- und Entwicklungsphase, wird jedoch bereits von Designstudios und Unternehmen getestet. Das Material ist vor allem für den Einsatz in den Bereichen Innenausstattung im Automobilbereich und Mode vorgesehen.

Exkurs: Gerbverfahren
Einen wichtigen Prozessschritt in der Lederproduktion stellen die Gerbverfahren dar, bei denen Tierhäute konserviert und strukturell stabilisiert werden, um sie vor Zersetzung zu schützen. Häufig kommen dabei giftige Chemikalien wie Chromsalze zum Einsatz, die Böden, Gewässer und die Gesundheit von Arbeitskräften belasten können. Auch in diesem Bereich kommt die Bioökonomie ins Spiel: mit biobasierten Gerbverfahren, die auf natürliche, nachwachsende Rohstoffe setzen. Dazu gehören pflanzliche Tannine aus Rinden, Blättern oder Früchten ebenso wie biotechnologisch erzeugte Enzyme und organische Säuren.
Seite 5 von 5
Ausblick
Die nachhaltige Transformation der Lederindustrie erfordert einen vielschichtigen Ansatz, der auf den Einsatz unterschiedlicher Rohstoffe, Technologien und Herstellungsverfahren setzt. Biobasierte Lederalternativen gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung. Zahlreiche Analysen prognostizieren für die kommenden Jahre eine deutliche Ausweitung des Marktes: Studien erwarten für den Zeitraum 2023 bis 2035 eine jährliche Wachstumsrate zwischen 6 und 15 % und belegen damit das wirtschaftliche wie ökologische Potenzial dieser neuen Materialklasse.
Das sozio-ökonomische Umfeld begünstigt diese Entwicklung zusätzlich: Ein wachsendes Bewusstsein für Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen fördert die Offenheit gegenüber innovativen Materialien, während die wissenschaftliche Forschung parallel große Fortschritte erzielt. Die derzeitige Dynamik lässt erwarten, dass sich in den kommenden Jahren ein vielfältiges und innovatives Spektrum biobasierter Materialien etablieren wird, das sowohl den industriellen Anforderungen als auch den gesellschaftlichen Erwartungen an eine nachhaltige Zukunft gerecht wird.